Die Operette kommt ins Kraftwerk
Im Rathaus sind sich seit gestern die Bürgermeister einig:
Das Musiktheater
zieht von Leuben an den Wettiner Platz.
SZ
vom 07.05.2008
Kommentar:
So schön und sinnvoll, eine Umnutzung leerstehender Industriearchitektur
vom Ende des 19. Jahhunderts auch ist, Dresden vermisst schmerzlich
einen klaren sichtbaren architektonischen Aufbruch ins 21. Jahrhundert.
Nach dem Beschluss, keine Kunsthalle auf dem Neumarkt zu bauen, nach
dem Sanierungsbeschluss für die Philharmonie im Kulturpalast
und nun für den Umzug der Operette ins Kraftwerk scheint kein
einziges Projekt mehr übrig zu bleiben, welches als NEUBAU
im Zentrum Dresdens an die großen architektonischen Vorbilder
anknüpft, gleichzeitig aber selbstbewußt eine starke
Gegenwartsarchitektur errichtet. Das ist für eine Weltkulturerbestadt,
die sich einer weltoffenen Zukunft verpflichtet, ein Armutszeugnis.
Der schöpferisch-kreative Geist Dresdens muss in Augenhöhe
mit der Traditionspflege einhergehen!
SZ
vom 28.05.08
Zitat: "Operette und Theater Junge Generation im Kraftwerk Mitte. Die
Stadt will das Industrieareal zu einem Kultur-Quartier gestalten.
.
.. Beide Spielstätten sollen von einer Passage vom Wettiner Platz erschlossen werden. ... Für die Operette wird das ehemalige Maschinenhaus genutzt. Es wird das Foyer, Gastronomie, Garderoben, Probebühnen und Technikräume aufnehmen. In Richtung Ehrlichstraße soll ein schlichter Anbau für den Zuschauerraum mit 700 bis 850 Plätzen, den gesamten Bühnenbereich und Künstlergarderoben erfolgen. Neben dem Neubau soll ein gemeinsames Werkstattgebäude für die Staatsoperette und das Theater Junge Generation errichtet werden. ... Für das Theater Junge Generation soll das ehemalige Umspannwerk verwendet werden. Schaltwarte als Foyer."
----------------------------------------------------------------------------------------
2006 wurde das eindrucksvolle Kesselhaus, architektonisches
Herzstück des ganzen Ensembles, durch die DREWAG abgerissen.
Seit Jahren lag eine Abriss-genehmigung des denkmalgeschützten
Kesselhauses vor. Die Drewag hätte sich um Investoren bemüht,
aber kein Interessent konnte - angeblich - die Finanzen aufbringen,
die kathedralenhafte Halle umzubauen. So wurde in wenigen Sommerwochen
des Jahres 2006- ohne jeden Protest der Dresdner Öffentlichkeit,
eines der signifikantesten Dresdner Gebäude, gleichrangig mit
Festspielhaus Hellerau oder Hygiene-Museum sang- und klanglos abgerissen.

Das Kesselhaus in einer Fotographie um 1930. In seinem klaren symmetrischen
Aufbau erinnert(e) der Bau an das zentrale Kesselhaus der Zeche
Zollverein in Essen.
Dieses Kesselhaus in Essen wurde wie die gesamte Anlage sogar 1994
zum Unesco- Weltkulturerbe erklärt. Selbst die Bauzeit 1928
- 32 entspricht der von Dresden. Architekten waren: Fritz Schupp und
Martin Kremmer. Siehe www.zollverein.de
-
Bild
- In Dresden werden stattdessen ähnliche Ikonen einer sachlich-funktionalen
Industriearchitektur auf dem Müll geworfen.

Das Kesselhaus während der Abrissarbeiten. (Foto:
S. Baumgärtel, 31.08.06)
Kraftwerk
Mitte
später Westkraftwerk
mit Phasenschieberhaus, Schalt-, Kessel- und Reaktanzenhaus
Um das alte Heizkraftwerk hinter der Semperoper abreißen zu
können, wurde das alte Lichtkraftwerk am Wettiner Platz durch
Neubauten mit modernsten technischen Anlagen zum Westkraftwerk erweitert.
Wolf fügte sie in die neogotische Anlage aus rotem Klinker ein,
indem er das Material aufgriff, es aber als Umhüllung der Ingenieur-
Stahlkonstruktion in kubische Formen mit flächigen Fassaden und
Flachdächern transponierte. Die monumentalen Baukörper,
die durch ein-
heitliche Materialien und Formen als geschlossenes Ganzes wirken,
staffeln sich zum stadtbildprägenden Volumen des Kesselhauses.
Der Gesamtkomplex dokumentiert die Entwicklung im Industriebau seit
1895 fast lückenlos. Seit der Stilllegung 1994 wird für
die zentral gelegene, herausragende Anlage eine neue Nutzung gesucht.
aus: Paul Wolf. Stadtbaurat in Dresden 1922- 1945, Ausstellungskatalog
des Deutschen Werkbundes Sachsen e.V. 2001
Paul Wolf 1919 über Industriestädte:
"Aus Zweck und Technik werden diese Schöpfungen zu neu-
artigen Formgebilden gestaltet werden müssen, als äußerer Ausdruck unserer industriellen Zeit. Freilich müssen wir uns zuerst dabei von den Fesseln der Romantik und des Eklektizismus befreien, die beim Industriebau keine Daseins-
berechtigung mehr habe. Poelzig's Wasserturm in Posen und sein Entwurf für ein Gasometer für Dresden sowie die industriellen Bauten der AEG von Peter Behrens mögen den Weg andeuten, der eingeschlagen werden muss."
(Zitat aus: P.Wolf, Das Formenproblem der Stadt der Vergangenheit u. Zukunft, Leipzig 1919)
Wolf's Enthusiasmus für das „industrielle Zeitalter“ blendete die Umweltschäden, z.B. durch starke Rußentwicklung der vier Schornsteine, aus. Unmittelbar am Werk lag dichte Wohngebiete.
Parallelen
Fast zeitgleich - 1927-28 baute Hans Poelzig das Kraftwerk Schulau an der Elbe in Schleswig Holstein, welches mit seinen gestaffelten Backstein-Kuben
und den vertikalen Fenstern sehr mit dem Dresdner Kraftwerk korrespondiert. Diverse Ansichten in der TU Berlin.
Hompepage:
DREWAG - www.drewag.de
Auf
dem Gelände des Gaswerkes Altstadt entstand 1895 ein elektrisches
'Lichtwerk'. Mit dem Westkraftwerk erhielt es 1900 ein spiegelbildliches
Pendant. Jeweils über langrechteckigem Grundriß errichtet,
nutzen Kessel- und Maschinenhalle eine Längswand gemeinsam. Die
Giebel der Maschinensäle enthielten hohe Fenster und wurden von
Türmen flankiert.
Beim Um- und Anbau 1927 zum Heizkraftwerk wurde über dem seither
als Schaltwarte dienenden Lichtwerk ein Abspannturm mit offener Galerie
errichtet und 1928 ein Heizhaus angefügt. Der mit rotem Backstein
verkleidete Stahlskelettbau überragt(e) mit massigen Kuben die
Gebäude der Umgebung. Seine vier Schornsteine weckten Assoziationen
an Dampfschiffe (Volksmund: "Panzerkreuzer Aurora"). Sie
wurden Mitte der 90er Jahre im Zuge der schrittweisen Stillegung abgetragen.
Stimmige Proportionen und warmer Backstein
Das gleichzeitig errichtete Schalthaus an der Stiftstraße entwickelt
sich aus langgestreckten Kuben, angenehm gegliedert durch farblich
hervorgehobene Backsteinreihen.
Die Proportionen von Abspannturm und Schalthaus sind von klarer Schönheit.
Allerdings gab es gegen das Baumaterial Klinker zur Bauzeit heftige
Vorbehalte wegen der Nähe des Zwingers.
Nach Jahren Leerstands wird das eindrucksvolle Heizkraftwerk 2013-2016 revitalisiert. Es entsteht eine gemeinsame Spieltstätte für die Operette und das Theater der jungen Generation. Andere Gebäude werden für die Kreativwirtschaft umgebaut.
Einem der imposantesten
Schlachtschiffe der Industrialisierung inmitten der Dresdner Innenstadt
wird somit neues Leben eingehaucht. Die eigenwillige Mischung
aus historisierender bis sachlicher Architektur des Neuen Bauens als Denkmal der Dresdner Bau- und Industriegeschichte gerät im 21. Jahrhundert neu in den Fokus. Darüber hinaus bietet die Architektur zum 26er Ring genügend Platz
für einen Anbau in zeitgemäßer Sprache.

Kesselhaus - Rückseite 2003 - Vergrößerung - Foto 1994 vor Abriss
Kesselhausabriss
- Großstadt-Ikone - ein Nachruf!
Das Kesselhaus, eine gigantische Halle mit kathedralenhafter Wirkung
des vergangenen Maschinenzeitalters Anfang des 20. Jahrhunderts, ist
systematisch durch offenstehende Fenster und undichte Dächer
dem Verfall preisgegeben worden. Dieses monumentale Schlachtschiff
der Moderne hätte auch nachfolgenden Generationen ein Beispiel
vom industriellen Aufbruchs Dresdens zur Großstadt demonstrieren
können, aber Verantwortliche haben den Abriss durchgesetzt.
Sicherungsarbeiten wurden im Prinzip nicht durchgeführt, so daß
der anfällige, rostende Stahl mit jedem Jahr hinfälliger
wurde. Die Dresdner Denkmalpfege zeigt sich zu (willens-) schwach,
diesen Koloß des Lichtwerks der Nachwelt zu erhalten. Ein Trauerspiel
!
In London z.B. wird historische Industriearchitektur zur meist besuchtesten
Galerie moderner Kunst umgebaut, in Dresden dagegen reißt man
solche Ikonen ab. Ein unglaubliches Versagen der DREWAG, der Dresdner
Denkmalpflege und vieler anderer Verantwortlicher! www.tate.org.uk
Selbst Cottbus hat sein altes Dieselkraftwerk (1927-28)
2008 in ein modernes Kunstmuseum umfunktioniert:
www.museum-dkw.de
Im Juli 2005 konnten eine Vielzahl der Gebäude für ein Kunstprojekt
www.elektrische-stadt.de
gewonnen werden.













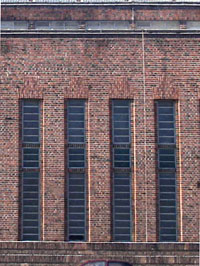

 Ansicht vom Wettiner
Platz: künftig ohne das Kesselhaus und damit ohne seiner pyramidalen
expressiven Steigerung - Foto: 2005
Ansicht vom Wettiner
Platz: künftig ohne das Kesselhaus und damit ohne seiner pyramidalen
expressiven Steigerung - Foto: 2005

 2005
noch vorhanden: riesige markante Stahlträger - gemacht scheinbar
für die Ewigkeit - Abriss: 2006
2005
noch vorhanden: riesige markante Stahlträger - gemacht scheinbar
für die Ewigkeit - Abriss: 2006
