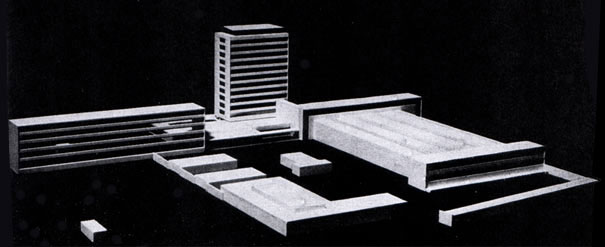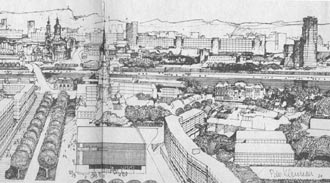|
|
Architekt: |
Wolfgang Hänsch |
|
Bauzeit: |
1960-
61 |
|
Kunst am Bau: |
Johannes Peschel
(Block aus Zement, 1975)
Rudolf
Sitte (Betonrelief im Hof, 1966) |
|
Sanierung: |
Martin Seelinger
2003
Infos dazu:
www.cornelsen-selinger.com |
|
Adresse: |
Ostra-Allee 20 (früher: Julian-Grimau-Allee)
|
Eröffnet im Jahr des Mauerbaus 1961
Das "Haus der Presse" ist (bzw. war) eigentlich ein ganzer
Gebäudekomplex - bestehend aus dem markanten 13-geschossigen
Redaktionshochhaus in Fertigplattenbau, den daran anschließenden
Flachtrakten, der (mittlerweile abgerissenen) Druckerei im hinteren
Teil der Anlage und dem Vorplatz mit Brunnenanlage und Politplastik.
Dieses (nicht mehr vorhandene) Zementkunstwerk stellte die Vereinigung
der beiden deutschen Arbeiterparteien KPD und SPD in Sachsen dar.
Jene manipulative Politplastik, die die Zwangsvereinigung der getrennten
deutschen Arbeiterparteien von 1946 unverschämt beschönigt,
wurde bald nach 1989 entfernt.
Das "Haus der Presse" genannte Ensemble markiert einen klaren
Wendepunkt in der DDR-Architekturpolitik für Dresden. Während
noch wenige Jahre zuvor dem Leitbild der "Nationalen Bautradition"
entsprochen wurde, nahm man mit diesem Verlagsneubau Abschied von
einer national gedeuteten Architektur und orientierte sich stattdessen
nach den Prinzipien der Architektur des Internationalen Stils.

Flagge
- seit 1959 mit Emblem: die DDR-Nation baut international
Kein einig deutsches Vaterland mehr, sondern D.D.R.
Der Druckerei- und Verlagskomplex, bereits 1958 konzipiert, setzte
den bereits begonnenen Trend zur ausgestellten Versachlichung fort.
Ein Festhalten an (vermeintlich) nationale deutsche Architekturtraditionen,
wie noch Anfang der 50er Jahre propagiert, wurde damit aufgegeben.
Jene Hinwendung von der so bezeichneten "nationalen" zur
funktionalistischen Architektur entsprang weniger eines ideologischen
Kompromisses, als viel mehr einer klaren Entscheidung zum Abschied
eines vereinten Deutschlands - durch die Zäsur des betonierten
Teilungszustandes in zwei getrennte Staaten.
Zudem kamen natürlich ökonomische Notwendigkeiten. Die industrialisierte
Bauweise konnte viel schneller und effizienter als eine handwerklich
geprägte Ziegelbauweise Ergebnisse erzielen.
International Style
Nur zum Vergleich: das Westberliner Hansaviertel zur IBA 1957 ist
von eben jenem International Style einer globalisierten und entregionalisierten
Moderne geprägt. Ebenso das 1963- 65 errichtete Berliner Europa-Center.
Damals empfand man diesen Stil als klaren Fortschritt, der keinerlei
vermittelnden Anschluß an die historische Stadt suchte. Jene
verstuckte "alte Stadt" assoziierte man eher als Ursache
für die Katastrophe des deutschen Faschismus. Ganz im Gegenteil
wollte sich damals das CDU/CSU-geführte Westdeutschland bewußt
durch neue städtebauliche und architektonische Lösungen
von der schrecklichen Vergangenheit abgrenzen. Ähnliche Bemühungen
von solcher architektonischer Vergangenheits"bewältigung"
(unter Ausblendung persönlicher Schuld) versuchte man dann, auch
auf vielfältig subtilen Druck der Adenauer-BRD, im betont sozialistischen
Teil Deutschlands (DDR).
So kann man das Dresdner "Haus der Presse" in seiner Gesamtanlage
als einen Affront zur bestehenden Stadtstruktur der Ostraallee und
aller hier vorhanden historischen Bezüge interpretieren. (Die
Permoser- und die Pöppelmannstraße wurden durch den SZ-Neubau
komplett überbaut). Man kann ihn allerdings auch einen Aufbruch
zu etwas völlig Neuem bezeichnen.
Das weit
zurückgesetzte, schroff-kubische Hochhaus nimmt keine Rücksicht
auf die vorhandene Traufhöhe der Gründerzeitbebauung, auch
nicht auf jenes Bürohaus des ehem. VEB Wasserwirtschaft (jetzt
mit gelben Dachziegeln) von 1958- 60 von Peter Kluge und K.H. Brade
gegenüber.

VEB Wasserwirtschaft
Historisch gewachsene, bürgerliche Städtebautraditionen
mit klassischer Blockrandbebauung wurde zugunsten eines offenen Ensembles
in orthogonaler Aufteilung, durchzogen von großzügigen
grünen Freiräumen aufgegeben. Der Baukörper stand
jetzt für sich und brauchte nicht mehr mit seiner Umgebung zu
korrespondieren bzw. den Dialog zu suchen. Er bildete eine eigene
Spannung von hohen vertikalen und niedrigen waagerechten Teilen. Allerdings
hatte bereits das Ensemble der VEB Wasserwirtschaft, ein Jahr früher
fertiggestellt, das Konzept der kompakten europäischen traditionellen
Stadt aufgegeben- zugunsten eines weit zurück
gesetzten differenzierten Baukörpers mit einem flachen Speisesaal
in moderner Form.
"Dresden schöner denn je"
Dieses Kompromisslose der Zeit bestätigt sich in dem wertschätzenden
Preis für das "beste Bauwerk der Stadt Dresden", welchen
der SZ-Komplex an
der Julian-Grimau-Allee (heute Ostra-Allee) 1966 erhielt.
Während allerdings die neue Prager Straße, ein paar
Jahre später errichtet, durchaus eine differenzierte Freiraumgestaltung
erfuhr, blieb das "Haus der Presse" trotz der Brunnenfläche
und der Politplastik für die Dresdner Öffentlichkeit als
zu nutzender städtischer Raum uninteressant.
Dennoch:
das jetzige SZ-Verlagshochhaus bildet ein Stück geformte Stadtsilhouette,
die mittlerweile ein Teil der Dresdner Architekturgeschichte ist.
Dekor, Mission und Konstruktion
Besonders nach der aufwändigen Sanierung 2003 mit einer neuen
kupfergrünen Glasverkleidung, deren Schmuck lose Folgen von Typographien
bilden, gewinnt der Komplex an Ausstrahlung (die Scheiben sind im
klassischen Siebdruck hergestellt worden). Selinger: "Das
Glas ist mit Schriftzeichen bedruckt, die durch Überlappung,
Spiegelung und Verzerrung verfremdet sind. Als Inspirationsquelle
dienten Texte aus ‚Vogelflüge – Essays zu Natur und Kultur‘ von Vilém
Flusser. Das zentrale Thema des tschechoslowakischen Medienphilosophen
und Kommunikationswissenschaftlers war der Untergang der
Schriftkultur.
Die Energiekosten sind im Vergleich zum vorherigen
Zustand auf unter 15 % reduziert worden, im Hochsommer liegen die
Büroraumtemperaturen nicht über 26 °C."
Die Druckerei ist komplett
in ein neues Druckhaus in den Dresdner Norden gezogen und deren Gebäude
wurde 2005 für Parkplätze und eine Grünfläche
abgerissen.
Der ursprüngliche Architekt des DDR- Pressehauses - Wolfgang Hänsch distanzierte
sich jedoch von der Sanierung durch Martin Seelinger ("typographische
Überschwemmung", "Verpackungsarchitektur"). Für
seine Generation scheint eine Rückkehr zu inhaltsbezogenen und
zugleich schmückenden Elementen an modernen Fassaden eine sehr
irritierende Herausforderung zu bedeuten, die die bisher gelehrten
Grundprinzipien einer Überbetonung des Konstruktiven in Frage
stellt.
Die einstigen an der Fassade des Hochhauses befestigten Buchstaben
"Haus der Presse" wurden als nostalgischer Rückblick
eines Neonröhren-Zeitalters hinter Glasvitrinen direkt an die
Straße gesetzt.
DDR-Hochhäuser
Neben dem SZ-Hochhaus wurde etwas eher mit dem Hochhaus in Dresden
Reick begonnen für den VEB Schokopack. Es wurde jedoch dann erst 1963
vollendet. Der Bau steht unter Denkmalschutz. Nach langem Leerstand
konnte es vorbildlich mit großem Aufwand 2018/19 für
die Software-Firma „Itelligence“ saniert werden.
|
|
        
"Haus der Presse"
vor der Sanierung, mit Buchstaben-Werbung- Foto: 2003 TK


das "P"
des Schriftzuges "Haus der Presse" - jetzt in einer Glasvitrine
direkt an der Straße aufgestellt.  
Rudolf Sitte: "Der
Produktionsprozess. Zeitungsdruck" 30 x 18 m, Betonrelief im Hof
des SZ-Gebäudes, 1966 (Ausschnitt)


Zum Vergleich: bereits
1957 wurde mit diesem 12-geschossigen Hochhaus in Dresden Reick begonnen:
Es gehörte zur ehemaligen Industrieanlange VEB Schokopack, 1957
- 63 von J. Junghans. 2008 wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Das selbe Gebäude von der Westseite nach der Sanierung. Foto:
T.Kantschew, August 2020,
Vergrößerung
|
|
Fortschritt, fortschrittlicher,
am fortgeschrittensten
Sächsische Zeitung - Organ der Bezirksleitung der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands (SED). Sonderausgabe vom 04. Juli 1969,
"Dresden schöner denn je"
Auf dem Höhepunkt einer internationalen Zukunftseuphorie
verloren auch Dresdner SED-Politiker und die Genossen Stadtplaner
jedes Gefühl für Proportion und Maß:
In dieser Sonderausgabe wurden die umfassenden Umgestaltungspläne
für das sozialistische Dresdner Stadtzentrum der Dresdner Öffentlichkeit
vorgestellt. Eine Vielzahl wesentlich höherer Hochthäuser
war für die Innenstadt vorgesehen, so z.B. eine Wohnhausgruppe
an der Stelle des jetzigen ICCD, welche doppelt so hoch wie das SZ-Hochhaus
gewesen wäre und die Elb-Silhouette mit einer rücksichtslosen
Hybris dominiert hätte.
Das Schauspielhaus wäre im Äußeren "kompromisslos"
modern umgebaut worden. Eine Menge Modellfotos verschaffen einen krassen
Eindruck dieser hyper-modernistischen Planungen, die, wenn sie je
umgesetzt wären, den Charakter Dresdens völlig verändert
hätten.
(mit einem Vorwort von Genosse Werner Krolikowski (Mitglied des ZK
der SED und 1. Sekretär der Bezirksleitung Dresden im Rechenschaftsbericht
an die IX. Bezirksdelegiertenkonferenz der SED)
Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt
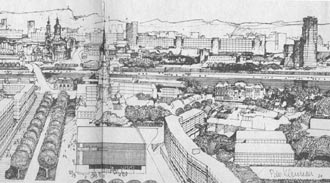
Hochkonjunktur, Wachstumsoptimismus und Modernitäts-Wahnsinn:
"Modell einer sozialistischen Großstadt" 1969 (rechts
im Bild: überdimensionierte Hochhäuser und Schnellstraße direkt
an der Elbe, vorn Albertplatz) - Vergrößerung,
Quelle. Sächsische Zeitung - Sonderausgabe vom 04.07.1969
Dresdens Stadtbaurat Kurt W. Leucht (1948- 1950 und 1966 bis 1969)
wird von Ulbricht in dieser Funktion abgesetzt, weil Leucht sich weigerte,
direkt an der Elbe Hochhäuser zu errichten.

Neue Kunst am Bau: farbig bearbeiteter Fotowandfries 2002 in der Mensa des SZ-Komplexes
(Ausschnitt)
|
|
|