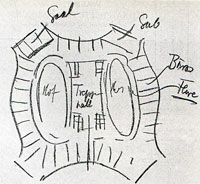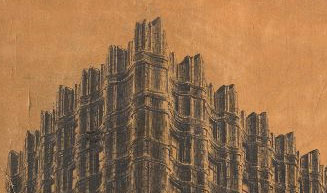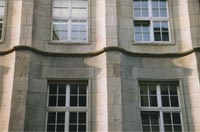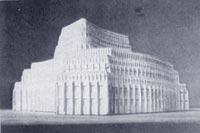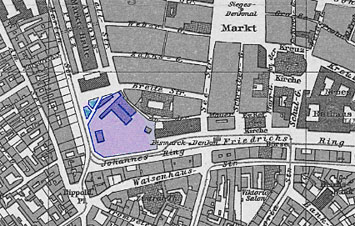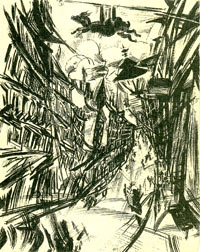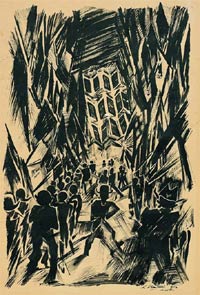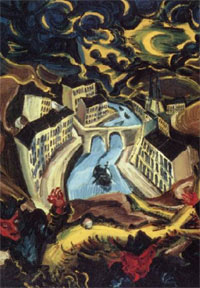|
Erbaut _._1922/23
Architekt: Ludwig Wirth (Erlweins und Poelzigs Mitarbeiter)
Adresse:. Theaterstraße 11- 13
Kraft, Charakter und Selbstbewußtsein
Das sind die Themen dieser eigenständigen außergewöhnlichen
Architektursprache. Auffällig an diesem modernen Verwaltungsgebäude
ist die ausdrucksstarke Ecklösung. Diese rasante, unkonventionelle
Kurve ist jedoch kein eindeutiges Rusultat städtebaulicher Neuschöpfung,
sondern folgte, Geschichte und Modernität genial verknüpfend,
der 1922 noch vorhandenen, mittelalterlich gekrümmten Vorstadtgasse
"Käufferstraße", die zum Postplatz führte
(seit 1863 nördl.der Wettinerstraße von Mittelstraße
umbenannt - jetzt Teil der nach 1945 geschaffenen Hertha-Lindner Straße).
Allerdings ergab die gewählte Grundrisslösung des Stadthauses
einen größeren Radius der Straßenkrümmung als
die Biegung vor 1922.
Das Stadthaus, als erweiternder Verwaltungsbau des Dresdner Rathauses,
war durch die 1921 vollzogene Eingemeindung von Blasewitz, Loschwitz
und Weißer Hirsch notwendig geworden. Dresden war nun in Flächenaus-dehnung
wie Bevölkerungszahl unübersehbar eine der wichtigsten deutschen
Großstädte geworden. Auf den Prozess der Modernisierung
und Citybildung stellte sich in dieser Zeit auch die Architektur ein.
Architektonisches Vorbild: Hans Poelzig
Das expressionistische Verwaltungsgebäude hebt sich positiv von
einer herkömmlichen gründerzeitlichen Blockrand-bebauung
ab und bringt dadurch diesem Areal der Wilsdruffer Vorstadt einer
erstaunliche Dynamik.
Beim näheren Betrachten fällt die dezente Zurücksetzung
der beiden oberen Geschosse auf, die wohl- laut Fritz Löffler-
auf eine Idee des Stadtbaurates Hans Poelzigs zurückzuführen
ist. Poelzig hatte selbst 1917 ein eigenen pathetischen Entwurf für
ein großes, sehr bewegtes Stadthaus abgegeben, welches sich
durch stufenförmigen, pyramidalen Aufbau auszeichnete und den
Stadtraum mit einer konvex und konkav geschwungenen Schaufassade belebt
hätte. Sein massiger Bau, der eine erhebliche Breitenwirkung
in Fachkreisen entfachte, ließ sich leider nicht realisieren.
Aber auch die langjährigen Amtsmitarbeiter Poelzigs Hirschmann
und Arlt waren an den Vorentwürfen und Modellen Poelzigs beteiligt,
so daß Wirth auf ein reiches Studienmaterial zurückgreifen
konnte.
In früheren Planungsphasen zog Wirth einen Standort an
der Marienbrücke Nähe Bahnhof Mitte in Betracht. Dieser Entwurf mit
Rundbögen im Erdgeschoss wurde jedoch nicht umgesetzt.
Weiche Rundung und Feinheit im Detail
Die ebenfalls wuchtige Gebäudemasse von Ludwig Wirth wird durch
umlaufende
Simse, aufgelöst in eleganten Wellenbewegungen, geschickt gegliedert.
Hohe schlanke Rundbogenportale fügen sich in die aufstrebenden
Vertikalen ein. Der verwendete Kunststein erwies sich als außer-ordentlich modellierfähig und noch dazu kostengünstiger als reiner Naturstein. Die verwendeten Fassadenplatten bestehen aus Muschelkalkstein-Vorsatzbeton. Von der Konstruktion her ist der Bau ein Stahlbetonskelett, die Hintermauerung dazwischen füllt eine 25 cm starken Backsteinmauer.
Der moderne 6-geschossige Betonskelettbau mit traditionellem schrägen
Ziegeldach ist ein seltenes Beispiel einer Mischung zwischen spätem
Expressionismus und früher Moderne. Aber gerade in dieser Stiluneindeutigkeit
liegt der eigentümliche Reiz dieser kraftvollen Großstadt-architektur,
die sich zu Dresden als einer herausragenden europäischen Metropole
bekennt. Trotz Inflationszeit und einer politischen Krise setzten
Bauherr und Architekt auf das Wachstumspotential Dresdens und auf
eine großstädtische Überformung der dörfliche
geprägten Gerbervorstadt.
Während wenige Jahre zuvor (1913) das Büro Lossow/Kühne
mit dem Schauspielhaus gegenüber dem Zwinger noch einem Historismus
verpflichtet war, entwickelt das neue Stadthaus einen ganz eigenständigen
originären Ausdruck, der noch nicht vom strengen Rationalismus
des "Internationalen Stils" beeinträchtigt ist und
nicht von der Diktatur des Rechten Winkel beherrscht wird.
Sanierung
1999 - 2000 sanierte die Dresdner STESAD denkmalgerecht das Stadthaus.
Dabei wurde auch der 1945 vollständige ausgebrannte Lichthof,
der erst 1958 bis 1961 vereinfacht wieder aufgebaut wurde, mit seinen
ehemaligen zackigen Pfeilerkapitellen in seine ursprüngliche
Form zurückversetzt.
Zur
Geschichte des Hauses
Ein deutscher Architekt der Mitte - ohne die Radikalität der
Neuerer
Wirth war jahrelanger Mitarbeiter von Hans Erlwein, dessen Auseinandersetzung
mit der Dresdner Bautradition er offenbar eine ganz eigene Auffassung
entgegensetzte. Auch sein Stadthaus hat zwar immer noch ein rotfarbiges
Ziegeldach und traditionelle Sprossenfenster, setzt in der Hauptsache
auf (Kunst-)Stein, anstatt auf das damals bereits von Mendelsohn und anderen
favorisierte Material Glas (sieht man einmal vom Lichthof ab), aber
die eigenwillige Abwicklung seiner Vorderfassade spielt auf ganz eigene
Weise mit wellenartigen Formen, mit Licht- und Schatteneffekten seiner
profilierten Werksteinfassade. Auch das expressionistische Treppenhaus
in geformten Beton knüpft mit einer ausdrucksstarken Interpretation
an die reiche Dresdner Gestaltungstradition von Treppenhauslösungen
an.
Interessant wäre auch eine fächerübergreifende Analyse
dieser Architektur mit Parallelen zu den literarischen, bildlichen
oder tänzerischen Avantgarden des Expressionismus zwischen 1905
und 1920 in Dresden. Gerade der hochgespannte Ausdruck eines neuen
Lebens - im Bruch mit den damals als überholt geltenden bürgerlichen
Werten hatte einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Schaffen
der in Dresden wirkenden Architekten. Die Vokabel Rhythmus
z.B. erfuhr nicht nur in den Tänzen von Mary Wigman oder Gret
Palucca eine neue Bedeutung- auch in der Architektur des Expressionismus
spielte die Suche nach einem Rhythmus, der das veränderte Leben
widerspiegelt, eine nicht unerhebliche Rolle, wie man z.B. am Stadthaus
und seiner rhythmisch auf- und abschwellenden Fassade beobachten kann.

Spätexpressionistische Architektur: Rhythmische
Wellenbewegungen + "atmende" Schwingungen, big |
| |

Tänzerin und Choreographin Mary Wigman
in einem expressionistischen Ausdruckstanz
1920. Foto: Hugo Erfurth, Dresden. |
Die
rhythmischen Wellen des Stadthauses von Wirth haben Ähnlichkeiten
und Parallen mit einem Entwurf für ein expressionistisches Bankgebäude
von Hans Poelzig aus dem Jahr 1920 (bzw. 1918). Da Wirth bereits Mitarbeiter
bei Stadtbaudirektor Poelzig war, wird er dessen Entwürfe und
Intentionen genau gekannt haben. Wirths Entwurf spielt mit den horizontalen
und vertikalen Linien des Poelzig'schen Bankhauses, das leider nicht
realisiert werden konnte.
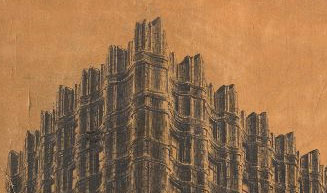
Hans Poelzig: Perspektivische
Ansicht Bankgebäude (Ausschnitt) am Ring in Dresden - nicht ausgeführter Entwurf ca. 1920

Städtebauliche Vorkriegssituation 1943 (Aufnahme:
Deutsche Fotothek/ SLUB)
Ludwig Wirth
1979 in Regensburg – 1946 in Garmisch-Partenkirchen
In Regensburg gebürtig, ist er von Hans Erlwein 1914 nach Dresden
berufen worden. Dort hat er als dessen und Hans Poelzigs Mitarbeiter
gewirkt. 1914 - 24 war er Abteilungsleiter im Hochbauamt, Stadtbaudirektor
und Regierungsbau-meister. 1925 gründete er in Dresden ein eigenes
Büro (bis 1935). Ab 1935 Wechsel nach Garmisch und dort eigenes
Büro.
Von seinen zahlreichen Projekten ist nur wenig erhalten geblieben.
Als "gemäßigter" Baumeister hatte er sich weder
in der Weimarer Republik noch in der NS-zeit als Architekt wirklich
durchsetzen können.
In der deutschen Öffentlichkeit ist er als Architektur-theoretiker
mit einer Publikation über Grundrißformen kleinerer Wohnungen
(Berlin 1919) in Erscheinung getreten.
Werke Wirths (u.a.):
- Beteiligung am deutschen Pavillon der internationalen
Hygiene-Ausstellung in Genua (1914)
- Beteiligung an der Hauptfeuerwache in der Dresdener
Neustadt (1914)
- Projekt für ein Garten- bzw. Ausstellungsrestaurant
(1918-19)
- Entwurf für das Pfarrhaus in Neu-Berzdorf (1920)
- Pläne für den Neubau eines Studentenhauses in Dresden
(1922) - bis 1925 wahrscheinlich Mitarbeiter an der Reali-
sierung in der Mommsenstraße
- Wettbewerbsprojekt für das "Nationale Hygiene-Museum"
am Zwinger (1921)
- "Vorprojekt" zu einer Großmarkthalle in Dresden und
Pläne
zu einigen privaten Wohnhäusern (undatiert).

Detail Fassade Stadthaus, Foto: TK 2012
Literaturtipp:
Ludwig Wirth: "Meine Arbeiten" - Sammlung von ca. 10 Entwürfen
und Dokumentationen von Projekten.
1913- 1935
Robin Halwas: Ludwig Wirth.
The architect’s drawings and other documentation for projects planned or built in Dresden, 1913–1935, preserved in his own portfolio.
2013
Text und Abbildungen:
www.ilab.org

Ludwig Wirth, früher Entwurf für ein neues
Stadthaus an der Marien-Brücke (rechts im Hintergrund: Bahnhof Mitte)
|
|

Stadthaus Dresden 1988, Foto: SLUB
Stadthaus Dresden in einer Aufnahme von 1957, Foto: SLUB
Stadthaus Theaterstraße 1976 - durch einen Neubau 1995 heute in dieser eindrucksvollen Breite so nicht mehr wahrnehmbar. Foto: SLUB
Stadthaus 1957, Foto: SLUB 
Stadthaus - im Hintergrund Schauspielhaus  Elegante Form eines Eingangsportals vom Neuen Stadthaus, Foto: TK Elegante Form eines Eingangsportals vom Neuen Stadthaus, Foto: TK
Expressionistisches Treppenhaus vom Stadthaus, Foto: TK 2004
Eleganten Wellen am Dresdner Stadthaus, Foto: TK 2004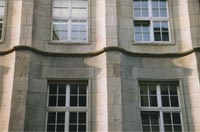
Foto: TK 2004 
Lichthof Stadthaus Dresden während der Zeit als Hauptbibliothek 1968 
Lichthof als Hauptbibliothek 1968 
Lichthof nach der Sanierung und Teilrekonstruktion (z.B. der expressiv zackigen Pfeilerkapitelle)
Stadthaus - Foto: TK April 2005

Stadthaus von hinten
- gut zu erkennen: Satteldach mit roten Dachziegeln. (Dez. 04)

Luftbild 31.05.1944
der Royal Air Force (Ausschnitt): Städtebauliche Situation des
Stadthauses und der geschwungenen Käufferstraße.
Eine Verbindung zur Ostraallee gab es bis 1945 nicht.


Stromlinienförmiges 1920er-Jahre-Design: Originalschild am Stadthaus, Foto: 2012 TK, Vergrößerung
 
Modellierbarer Kunststein, Der Eingang wird strahlenförmig betont. Foto: TK


Pfeilerkapitelle im Bürgersaal, 1.OG, Foto: TK


|
|
Material & Umfeld
Dresdner Hefte Nr. 72 - "Unruhe über der Stadt. Dresden
und der Expressionismus" 2002.
Almai, Frank: Expressionismus in Dresden. Zentrenbildung der literarischen
Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland, 2004.
Schrei in die Welt. Expressionismus in Dresden. Berlin (Ost) 1988,
Lizensausgabe für die BRD, Westberlin, Österreich und die
Schweiz, Hrsg. v. Peter Ludewig.
Wolfgang Pehnt, Die Architektur des Expressionismus, 1998, Hatje Verlag.
Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur II.
Die Architektur der Reform (1900 - 1924), in:
53 Arch+ , Sept. 1980
Heike Hambrock: Bauen im Geist des Barock. Hans und Marlene Poelzig. Architekturphantasien, Theaterprojekte und moderner Festbau (1916-1926), Berlin 2005
"Fragments of Metropolis – Berlin", Hg. Christoph Rauhut, Hirmer Verlag, München 2015
https://vielfaltdermoderne.de/stadthaus-dresden
Fotos von
Daniela Christmann 2023 vom Stadthaus Dresden innerhalb ihres
Projektes "Vielfalt der Moderne. Architektur und Kunst 1900 bis 1935"
Expressionismus
in Dresden
Eine Ausstellung - organisiert von der TU-Dozentin Tanja Scheffler
und Studenten - zeigte expressionistische Architektur in Dresden.
SZ vom 24.06.05: "Anlässlich des 100-jährigen Gründungsjubiläums
der Künstlergruppe BRÜCKE, deren erste Protagonisten sich
bekanntlich als Architekturstudenten an der Dresdner TH (später
Uni) betätigten, realisierten Studenten des Lehrstuhls für
Baugeschichte besagte Exposition. Im ehemaligen Schalthaus des Heizkraftwerkes
Mitte dokumentieren Schautafeln, Fotografien und Zeichnungen beispielhaft
expressionistische Architektur in Dresden. Darunter firmieren Objekte
wie die Litfaßsäule am Güntzplatz und das Lingnermausoleum
(expressionistische Vorentwürfe- u.a. Hans Luckhardt). Filmvorführungen
und eine thematische Architekturführung runden das Angebot ab.
Studenten der Gestaltungslehre zeigen ihre Auseinandersetzungen mit
Farbe und Bildkompositionen expressionistischer Gemälde; die
Fakultät Grundlagen des Entwerfens steuert expressionistische
Entwurfsobjekte bei."
|
|
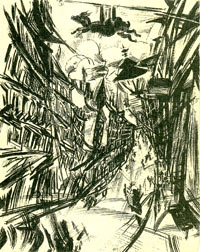
Ludwig Meidner,
Die Alaunstraße in Dresden, 1914 (Vergrößerung),
Meidner wars einer der bedeutendsten Vertreter des urbanen Expressionismus.
Er lebte von 1914 bis 1916 in Dresden.

Ludwig Meidner, Das Eckhaus (Villa Kochmann, Dresden), 1913 Öl
auf Leinwand, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid / Vergrößerung
"Malen wir das Naheliegende, unsere Stadt-Welt! die tumultuarischen
Straßen, die Eleganz eiserner Hängebrücken, die Gasometer,
welche in weißen Wolkengebirgen hängen, die brüllende
Koloristik der Autobusse und Schnellzugslokomotiven, die wogenden
Telephondrähte (sind sie nicht wie Gesang?), die Harlekinaden
der Litfaßsäulen, und dann die Nacht... die Großstadt-Nacht
(...)
Wir müssen endlich anfangen unsere Heimat zu malen, die Großstadt,
die wir unendlich lieben. Auf unzähligen, freskengroßen
Leinwänden sollten unsre fiebernden Hände all das Herrliche
und Seltsame, das Monströse und Dramatische der Avenüen,
Bahnhöfe, Fabriken und Türme hinkritzeln. (...) Es ist nicht
möglich mit der Technik der Impressionisten unser Problem zu
bewältigen. Wir müssen alle früheren Verfahren und
Trucs vergessen und ganz neue Ausdrucksmittel uns zu eigen machen."
aus: Ludwig Meidner, Anleitung zum Malen von Großstadtbildern.
Aus: Das neue Programm, in: Kunst und Künstler 12 (1914).
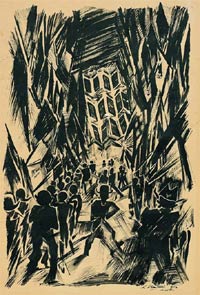
Ludwig Meidner, Webergasse in Dresden, 1913
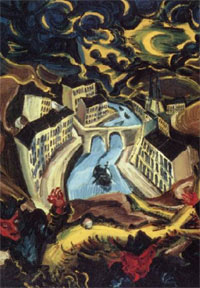
Apocalyptische Landschaft, 1916 (Ausschnitt), |