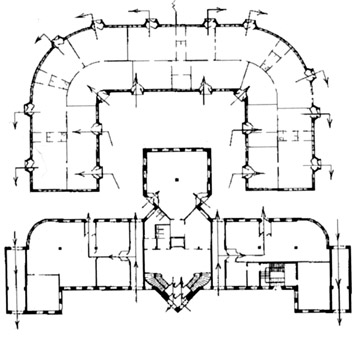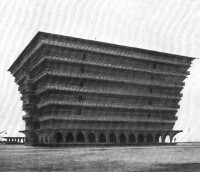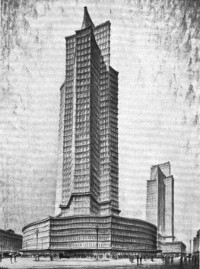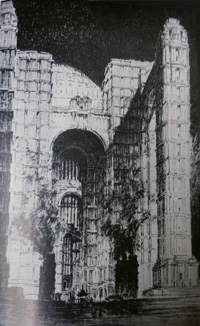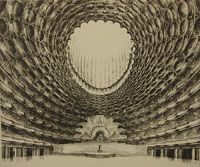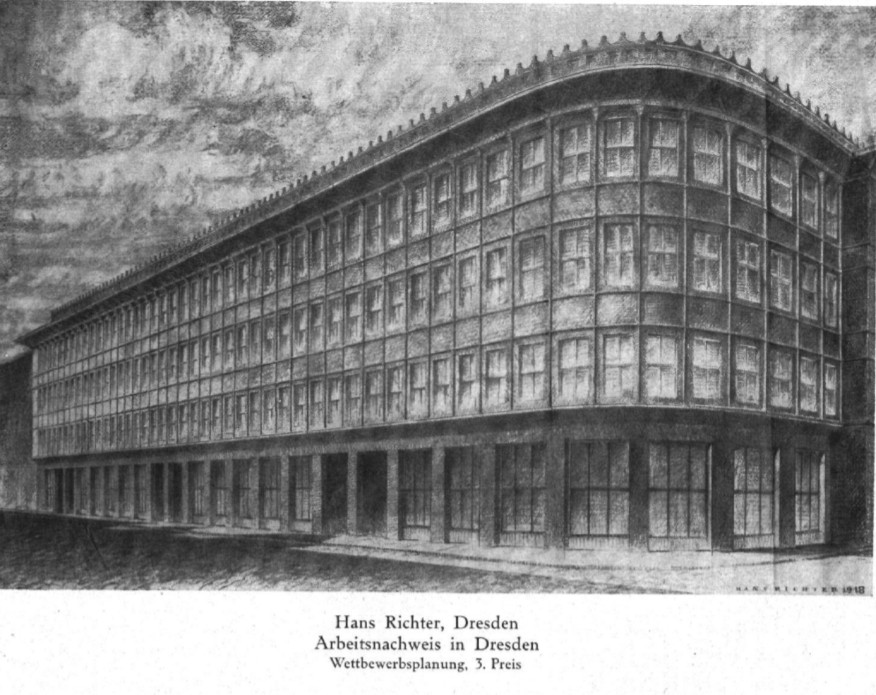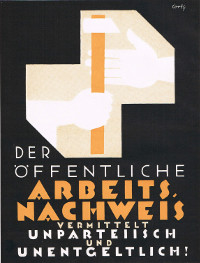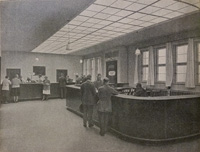|
| Architekt: |
|
Hochbauamt der Stadt Dresden
(Leitung: Paul
Wolf)
Stadtbaudirektor Carl Hirschmann
Künstlerische
Beratung: Paul Andrae
|
|
Raum-programm: |
|
Direktor Arbeitsnachweis Dresden:
Oskar
Nerschmann |
| Bauzeit: |
|
1925 - 26
|
|
Adresse: |
|
Maternistraße
17 |
heutige
Nutzung: |
|
verschiedene Institutionen, u.a.
Privatboulevardtheater
(Zu DDR-Zeiten SED-Parteischule) |
Beim ersten Neubau eines Arbeitsamtes in der Weimarer Republik wurde
auf Funktionalität besonderes Augenmerk gerichtet. Abteilungen mit
starkem Publikumsverkehr wurden in das EG gelegt und durch jeweils
zwei Eingangs- und Ausgangshallen sollte eine Führung des Publikums
erreicht werden. Die meistfrequentierten Abteilungen befanden sich in
einem U-förmigen Hintergebäude. Durch eine variable Gliederung der
Räume sollte der Bau für Veränderungen offen sein, Arbeitssäle
optimale Raumnutzung gewährleisten.
Der klar gegliederte, symmetrische
Bau ist in seinem Mittelteil zurückgesetzt und stößt mit einem
prismatischen Treppenhaus mit Langfenstern bis zur Flucht der beiden
seitlichen Baukörper vor. Während die Vorderfront noch weitgehend
erhalten ist, sind im Inneren einschneidende Veränderungen erfolgt.
(Text aus. Architekturführer Dresden, Hrsg. von G.Lupfer, B.
Sterra und M.Wörner, Dresden 1997)
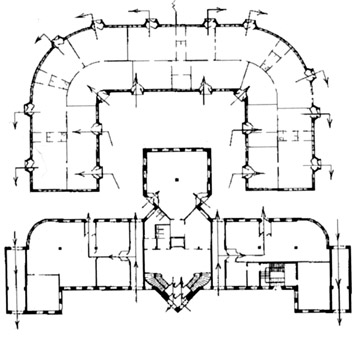
Grundriss des ursprünglichen Gebäudekomplexes an
der
Maternistraße. Der hintere einstöckige Teil wurde im Krieg zerstört.
Der Grundriss offenbart eine ziemlich effiziente
Organisation der Arbeitsvermittlung. Durch die mittleren Türen erfolgte
der Einlass. Im hufeisenförmigen Hofgebäude ("Ringbau") gab es weitere
differenzierte Bearbeitungsräume. Arbeitssuchende verließen diese dann in den äußeren Hof und
kamen an den Außentoren zurück
zur Straße. Der Verwaltungsbau war also konzipiert für einen massiven Durchlauf von Arbeitssuchenden.
In der funktionalen Organisation der Besucherströme ist es ein Vorläufer des
bekannten Dessauer Arbeitsamtes von Walter Gropius aus dem Jahr 1928 (Infos).
Neben den individuellen Beratungsräumen, nach Fachabteilungen untergliedert,
gab es im Haus einen großen Sitzungssaal und kleinere Säle für
Berufsberatungen sowie eine Dienstwohnung im 4. OG. (Abbildung
3. OG)

Dreiecksspitze, Foto 2015 TK
Architektur
Neue Sachlichkeit,
expressionistische Elemente, aber auch jede Menge Rundungen.
Horizontale Linien geben dem Gebäude einen ruhigen Duktus, während die
vertikalen Fensterbänder im dreieckigen Treppenhaus eine expressive
optische Dynamik erzeugen. Insgesamt ergibt sich jedoch ein etwas
unentschiedener Eindruck mit den verschiedenen Formen - wie den
traditionellen Rundbögen und dem herausragenden expressiven Zacken,
der nur bedingt dem "Neuen Bauen" zuzurechnen ist. Schöne
Profil-Details findet man in den Formen für Sockel u. Fenstergewänden
in Muschelkalk.
Beeindruckendes Treppenhaus
Unerwartete architektonische Raffinesse begegnet dem Besucher im
Treppenhaus, welches dann gar nicht mehr so zackig daher kommt, wie
von außen vermutet, sondern in einem ausgeklügelten Rhythmus fließender Formen. Carl
Hirschmann beschreibt es in der Festschrift als "Fanfare, die
schon vom Äußeren vom Terrain bis zum Dach ungebrochen und bestimmend
(auf)- schießt".
Die gesamte U-förmige Hofbebauung ist
1945 zerstört worden. Die SED baute stattdessen für ihre Parteischule
einen kleinen neuen Schulungssaal, der heute als Privattheater genutzt
wird.
Während der Instandsetzung in der Nachkriegszeit wurde das
Hauptgebäude teilweise vereinfacht wieder hergestellt. So verzichtete
man z.B. auf die markanten Stufengiebel zur Hofseite.
Das Gebäude steht heute unter
Denkmalschutz.

Öffentlicher Arbeitsnachweis Südseite und
einstöckiges Hofgebäude mit Oberlichtern,
Vergrößerung, Quelle: Stadtplanungsamt Dresden

Ehem. Arbeitsnachweis Maternistraße, Foto 2015 TK
Vergleich zum Entwurf eines Arbeitsnachweises
von Hans Richter, der im Wettbewerb 1920 den 3. Platz errang:
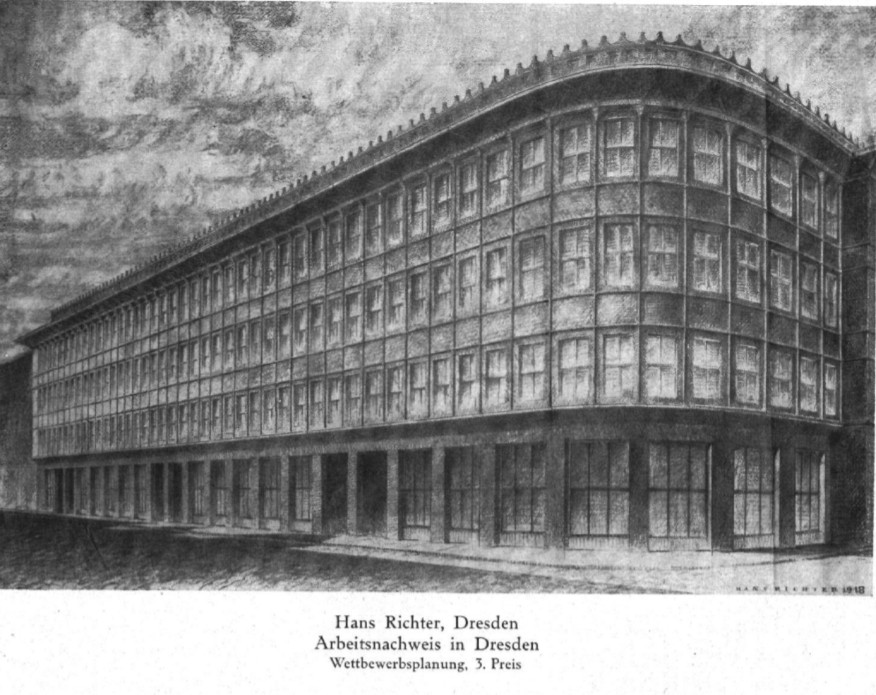
Vergrößerung,
Grundriss (mit getrennten Männer- und Frauenbereichen)
Bereits 1920 fand in Dresden der Wettbewerb zu einem Arbeitsnachweis
statt, allerdings für ein anderes kleineres Grundstück an der
Theaterstraße. Der bekannte böhmisch-deutsche Architekt Hans Richter entwarf
ein konzentriertes Gebäude im neusachlichen Stil, setzte jedoch als Schmuck eine
expressionistisch-wellenförmige Zackendachleiste auf.
Ein anderer
Wettbewerbsbeitrag kam von Gustav
Lüdecke.
Da 1922 an der Theaterstraße das große neue Stadthaus
errichtet wurde, wich Paul Wolf auf ein anderes Grundstück an der
Maternistraße aus. Carl Hirschmanns und Paul Andraes Entwurf aus dem Jahr 1925
konnte 1926 fertig
gestellt werden.
Arbeitslosigkeit in der
Weimarer Republik
Der erste Neubau eines Arbeitsamtes war in Dresden notwendig
geworden, weil seit 1918 der Arbeitsnachweis zentralisiert worden war,
dennoch aber verschiedene Dienststellen bestanden. (Hintergründe: "Zwischen
Burgfrieden und Klassenkampf, ab S. 177)
Direktor Dr. Nerschmann, Dresden
sprach anläßlich der Eröffnung des neuen Gebäudes
1926:
Was leistet der Öffentliche Arbeitsnachweis?
Die Nachkriegsjahre haben auf dem Arbeitsmarkt ganz neue
Verhältnisse geschaffen. Mit der Gewalt elementarer Ereignisse brachen
Wirtschaftskrisen oft in rascher Folge nacheinander herein u. ließen
die Zahl der Arbeitslosen allein im Wirtschaftsgebiet Dresden bis auf
über 60 000 empor-
schnellen. Kaum ein Betrieb zeigte eine stetige
und gleich-
mäßige Beschäftigung. In jähem Konjunkturwechsel
erfolgten bald Neueinstellungen, bald Entlassungen, so daß der
Arbeitsmarkt der letzten Jahre ständig unter dem Zeichen stärkster
Beunruhigung und Unausgeglichenheit stand. (...)
Das
Vermittlungsgebiet ist daher in 40 Fachabteilungen aufgeteilt.
Hierdurch ist es möglich, daß für jede Berufsgruppe besonders
fachkundige Vermittler tätig sind, die sich über die Eigenart und
Anforderungen der einzelnen Betriebe u. die Fähigkeiten der Bewerber
ein selbständiges Urteil bilden können. (...)
So mustergültig die
innere Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises Dresden
ausgestaltet ist, so ungünstig, um nicht zu sagen unwürdig, ist
teilweise seine bisherige räumliche Unterbringung. Es ist daher sehr
zu begrüßen, daß die Stadt Dresden als Verwaltungsgemeinde nicht die
Mittel gescheut hat, dem Arbeitsnachweis auf dem städtischen
Grundstück Maternistraße 17 ein neues, der Eigenart des
Arbeitsnachweises entsprechendes Gebäude zu errichten. Die
Raumaufteilung erstrebt vor allem eine klare zwangsläufige Regelung
des Massenverkehrs.
Das Gebäude des ÖffAN
in Dresden galt nach Fertigstellung als "ein Muster, ein Ansporn, eine
Hoffnung für alle gleichartigen Arbeitsnachweise". Es war konzipiert
worden, ohne dass Raumprogramm und Raumgruppierung als bewährtes
Vorbild zur Verfügung standen, quasi ein Prototyp.
Arbeiterbezirk Wilsdruffer
Vorstadt und Cotta
Das erste Dresdner
Arbeitsamt wurde nicht in den bürgerlichen Bezirken Blasewitz, Striesen oder
Loschwitz errichtet, sondern im Arbeiterbezirk Wilsdruffer Vorstadt,
wo am Anfang des 20. Jahrhunderts jede Menge Arbeiterfamilien wohnten,
die durch Inflation und Wirtschaftskrisen zu Tausenden arbeitslos
geworden waren.
|
 |

Arbeitsnachweis Wilsdruffer Vorstadt

Treppe Ehemaliger Arbeitsnachweis Dresden, Foto: TK 2016

Fließend schwingender Treppenhandlauf, Foto: TK 2016

Treppenabsatz, Foto: TK 2016,
Vergröß.

Treppenrhythmus, Foto: TK 2016,
Vergröß.

Treppenanlage, Foto: TK 2016

Foyer, Foto: TK 2016,
Vergrößerung

Hintergebäude, Foto: TK 2015,
Vergröß.

Rückseite Arbeitsnachweis

Portalkennzeichnung
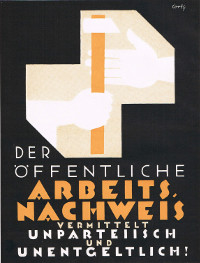
Werbeschrift für den Öffentlichen Arbeitsnachweis,
Dresden 1926

Vordach, Foto: TK 2016

Zurück gesetzter Baukörper, Foto: TK 2016
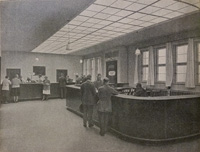
ÖffAN Dresden, Vermittlung- und Unterstützungsstelle der
Fachabteilungen für Nahrungsmittelgewerbe und Zigaretten-Industrie,
Foto 1926,
Vergröß
Foto
der Gastwirts-Fachabteilung im ÖffAN Dresden

Öffentlicher Arbeitsnachweis 1926 nach Fertigstellung,
Vergröß
Ursprünglich hatte, wie man sieht, das Gebäude eine
viel kontrastreichere farbliche Gestaltung. Sämtliche Simse, Ecken und
Kanten waren in einem hellen Ton gestrichen, während sich die
Wandfläche deutlich dunkler absetzte. Leider wurde diese Fassaung bei
der Sanierung nicht wieder hergestellt.
|
|
|
Karl Paul Andrae
(* 6.
Oktober 1886 in Dresden ; † 13. Februar 1945 ebenda)
"Zeit der Gärung"
Der heute fast unbekannte
Paul Andrae war in den 1920er Jahren in Fachkreisen deutschlandweit
bekannt. Als "Dresdner
Hochhausvisionär" machte er bereits 1913-16 mit einem höchst
beachtlichen Zeichnungskonvolut auf sich aufmerksam mit dem Titel
»Das größere Berlin«. Nichts davon wurde zwar je gebaut, aber seine
hochfliegenden Pläne wurden durchaus zur Kenntnis genommen und
reflektiert.
Herbert Conert schätzte ihn z.B. als jungen utopistischen
Visionär, der neben dem pragmatischen Hans Richter mit seinen
dynamischen Skizzen zu überzeugen weiß: Zwei Richtungen treten in Dresden deutlich in
Erscheinung; die alte, seit Jahrzehnten bekannte, an die historische
Dresdner Baukunst sich anschließende und eine eigene Wege gehende,
kraftvoll-subjektiv arbeitende, Weg weisende Richtung. (...)
Paul
Andreas Arbeitsgebiet sind die Monumentalbauten, die Hoch- und
Turmhäuser und Speicher. Er wirft die Planungen nicht als flüchtige
Skizzen hin, sondern schafft sie schrittweise; ein Plan ersetzt einen
anderen, bis sich schließlich der Gedanke, dem er Ausdruck geben will,
voll durchgerungen hat.
Er beschäftigt sich in Architekturformen mit
Ideen, die die Zeit beherrschen; es sind dynamische
Entwicklungsstudien. Mögen seine Arbeiten bis zu einem gewissen Grade
utopistisch sein, gewiß, sie wollen es sein; sie wollen
architektonische Untersuchungen für Zukunftsziele vorstellen, und
sind als solche zu bewerten. Es sind Zeitbilder geistigen Schaffens,
wie sie eine schnellebige Zeit nicht mehr gekannt hat.
Herbert Conert über Paul Andrae in: Wasmuths Monatshefte für Baukunst
und Städtebau. Ausgabe 7.1922/23
Paul Andrae Lebensweg ist von erstaunlichen Wandlungen
gekennzeichnet.
Studium bis 1911 in Dresden, u.a. Schüler Paul Wallots, anschließend
unklare Einkommens-verhältnisse. Es folgen himmelsstürmende Hochhaus-visionen für Berlin, dann
1919 die Revolution im deutschen Reich und besonders auch Dresden, in dessen Zuge Andrae
(als einziger Dresdner Architekt) das Berliner
Manifest des Arbeitsrates für Kunst
unterzeichnete und an der Ausstellung für unbekannte
Architekten teilnahm. Andrae besaß
ein großes Zeichentalent, entstammte einer Dresdner Künstlerfamilie,
verstand sich als Architekt und Künstler.
Von 1917 - 23 stellte er
in der "Dresdner Kunstgenossen-schaft" aus, dessen Vorstand er war.
In den 1920ern zeichnete er atemberaubende urbane
Großstadtfigurationen, die den Rahmen zu sprengen scheinen oder
expressionistisch-kristalline Spiegelraum- träume, in der sich Prismen im
Unendlichen brechen.
Ab Mitte der zwanziger Jahre bis 1928 ist er
künstlerischer Berater des Dresdner Hochbauamtes und leitender
Mitarbeiter von Baudirektor Carl Hirschmann, davor wohl seit 1919 nur eine
Art freier Mitarbeiter. (1)
Nach
der Machtübernahme der Nationalsozialisten baute Andrae am Königsufer der Dresdner
Neustadt den neobarocken Milchpavillon und entwirft - ebenfalls im Heimatstil
- das neue Narrenhäusel-Interieur beim Umbau zum Restaurant.
Maßgeblich ist er an den Planungen zur Neugestaltung des Königsufers
involviert.
Zeichnung Andrae
1937 wurde er Mitarbeiter der zunehmend in Sinne der NS-Ideologie
tätigen Dresdner Stadtbauverwaltung, die sich anschickte, die
"Gauhauptstadt Dresden" als überdimensionierte Verwaltungs- und Aufmarschstadt
zu errichten. Unter anderem ist er mit dem Projekt
Sportforum
Ostragehege betraut sowie der Planung für die Umgestaltung des
Speicherviertels an der neuen Terrasse zu einem repräsentativen
Kulturforum - beides auf Überwältigung zielende
Monumentalarchitekturen. Man kann sich fragen, wieso ein
Moderne-Visionär mit utopischen Entwürfen sich dann so vorbehaltlos
den nationalsozialistischen Umgestaltungsplänen unterwirft, diese
maßgeblich mit gestaltet. Leider sind die Personalunterlagen des
Dresdner Hochbauamtes 1945 verbrannt, so dass es kaum erhaltene
Quellen zu ihm gibt. Dennoch wäre eine vertiefende Beschäftigung mit
diesem außerordentlichen Dresdner Architekten und seinem Werk eine
lohnenswerte Aufgabe.
Vielleicht lohnt ein Blick auf sein
Frühwerk: in architektonischen Skizzen mit den Bezeichnungen "Andante
maestoso" oder "Allegro tanto" von 1912-13, aber auch in der Serie
"Das größere Berlin" zeichnet er Fantasien von imperial auftrumpfender
Größe, die in schwerer Monumentalität und sakralem Ernst neoantike
Formen wieder beleben möchten.(2) Dieses Streben nach maßloser,
schrankenloser Hybris hätte er in seinen Projekten am Elbufer nach
1937 verwirklichen können.
Andrae kam am 13.Februar 1945 bei dem
alliierten Angriff auf Dresden ums Leben. Wohnort war die
Mosczinskystraße 21 in der Seevorstadt West.
Literatur:
Wilhelm
Bökenkrüger: Das neuzeitliche Arbeitsnachweis-Gebäude. (= Bücherei
des Öffentlichen Arbeitsnachweises, Serie II, Heft 7/9.) Kohlhammer,
Stuttgart 1926
Nerschmann, Oskar: "Vom Wesen der öffentlichen
Arbeits-vermittlung", In: Der Neubau des öffentlichen
Arbeitsnachweises Dresden und Umgebung. Eine Werbeschrift anlässlich
der Eröffnung des neuen Gebäudes, Dresden Oktober 1926.
Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit,
Berlin 1927, S. 546, 405
2) Kurt Hager: Architekturskizzen
des Architekten Paul Andrae,
In: Das Bild.
Monatsschrift für das Deutsche Kunstschaffen in Vergangenheit und Gegenwart,
7 (1937), S. 241 ff.
Herbert Conert:
Dresdner Baukünstler, In: Wasmuths Monatshefte für Baukunst und
Städtebau. Ausgabe 7.1922/23
Paul Andrae: Zum Wettbewerb
Hygiene-Museum,
In: Wassmuths Monatshefte für Baukunst und
Städtebau; 6 (1921/22), S. 41/42 ff,
http://digital.zlb.de
Florian
Zimmermann: Der Schrei nach dem Turmhaus: Der Ideenwettbewerb Hochhaus
am Bahnhof Friedrichstraße, Berlin, 1921/22, Berlin 1988, S. 242-245
(1) -
Tanja Scheffler:
Hans Poelzig - Unbekannte Entwürfe für Dresden, in: architectura -
Zeitschrift für Geschichte der Baukunst / Journal of the History of
Archtecture 1/ 207
FN 7, S. 3
Quellen:
Zeichnungsentwürfe von Andrae liegen im
Stadtplanungsamt Dresden (Bildstelle). Unter anderem überrascht dort
der Entwurf für ein "Hotel Saloppe", datiert vom 30.7.1941 mit einem
schlossartigen Hotelneubau oberhalb der Saloppe als vierte Ergänzung
der drei Elbschlösser in historisierender Formensprache mit einem
schlanken Turm, Treppen, Terrassen und repräsentativem Zugang zur
Elbe.
Oder: Ein expressionistisches Probjekt
mit Carl Hirschmann am Wiener Platz "Bürohaus und Fremdenhof" mit
voluminösem Saalbau, datiert vom 15.9.1921
Text: Dezember 2016 /
T.Kantschew
|
|

Paul Andrae. Entwurf: "Das größer Berlin VIII", 1913,
Vergrößerung

P. Andrae, Entwurf für ein Warenhaus, vor 1922,
Vergrößerung
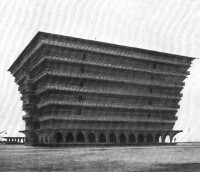
Paul Andrae, Entwurf für einen Speicher,
vor 1922,
Vergrößerung
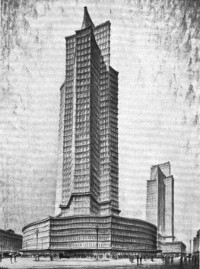
Paul Andrae, Turmhaus, dynamische Studie,
vor 1923,
Vergrößerung

Paul Andrae, Spiegelgalerie Raumstudie, um 1921,
Vergrößerung

Paul Andrae, Enwurf Messehalle 1924,
Vergrößerung
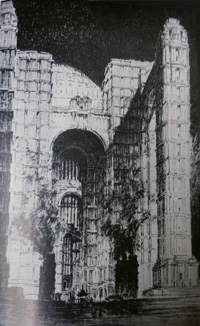
Paul Andrae, "Andante maestoso" 1912

Paul Andrae, "Das größere Berlin", 1916 Federzeichnung,
Vergrößerung,
Teil 2
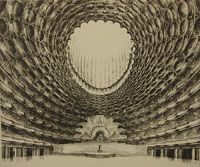
Ekstatisch-monumentaler Entwurf für einen großen Konzertsaal in einem Hotel am Wiener Platz. 1921 vom Hochbauamt
Dresden (Carl Hirschmann) u. Paul Andrae
Vergrößerung (Foto: TK 2019) |