|
Architekt: Coop Himmelb(l)au
(Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky)
Bauzeit: _1996-98
Adresse:.
Petersburger Straße
Ein Solitär
als verkörperter Individualismus
"In klarer, geometrischer Ordnung bilden die schlanken Scheibenhochhäuser
an der Prager Straße in Dresden ein städtebauliches Ensemble,
das mit dem Hauptbahnhof im Süden und dem Übergang zum Altmarkt
im Norden ein typisches Ergebnis der Stadtplanung der 60er Jahre ist.
Diesem Ensemble wurde mit dem Kinozentrum ein weiteres Element hinzugefügt,
das einen neuen öffentlichen Raum östlich der Prager Straße
definiert und damit zugleich die Querbezüge zur großen
Achse verstärkt. Zur Belebung dieses neu gewonnenen urbanen Raumes
werden sämtliche Zugänge zum komprimierten "Kinoblock"
als öffentliches Ereignis inszeniert. Das weite Foyer, die skulputral
ausgeformten Treppenanlangen, die in einen Drahtkegel eingehängte
Bar und zusätzliche Servicefunktionen werden weithin sichtbar
in den öffentlichen Raum eingestellt und von einer kristallinen
Stahl-Glaskonstruktion umfasst, die diesem neuen Treffpunkt inmitten
der Stadt ein einprägsames Zeichen mit weiter Ausstrahlung gibt.
In bewegtem Kontrast zu den sonst zumeist monofunktional konzipierten
und im Gefüge der Stadt hermetisch abge- schlossenen Baukörpern
solcher Unterhaltungsmaschinen wird hier dem Publikum eine vielfältig
bespielbare Bühne gegeben, auf der sich vor allem die jüngere
Generation spielerisch
darstellen kann. Durch die
Sichtbarkeit der Bewegungen und Interaktionen im - zumal abends hell
erleuchteten "Kristall" wird der transparente Baukörper
selbst gleichsam zu einem Medium der Öffentlichkeit, daß
für die Wiedergewinnung von Urbanität in unseren Städten
einen beispielhaften Beitrag leisten kann.
In der expressiven Formensprache kommt gegenüber der strikten
Geometrie der Umgebung eine fast anarchisch anmutende Vitaliät
zum Ausdruck, die gerade in dieser Gelenksituation zwischen Altstadt
und Nachkriegsmoderne einen bemerkenswerten, zukunftsweisenden Akzent
von hoher gestalterischer Qualität setzt."
(Text aus der Laudatio zur Verleihung des Deutschen
Architekturpreises 1999)
Zur
Straße den Rücken, zur Gasse die Schauseite
Diese einmalige, unverwechselbare Gebäudeskulptur hat durchaus
eine vordere Schauseite und eine hintere Rückseite. Die Vorderfront
mit dem offenen, gläsernen Foyer zeigt auf die namenlose Gasse
zwischen Prager- und Petersburger Straße. Zur viel befahrenen
Europa- Hauptstraße E 55 präsentiert das Kino eine verschlossene,
schroffe Rückseite, also eher den "Rücken" als
ein "Gesicht". In diesem Riegel befinden sich die eigentlichen
Kinosäle. Schade, dass man der wichtigsten Verkehrsachse
der Stadt so wenig gestalterische Beachtung schenkte.
Doch man nimmt sie im allgemeinen mehr als Transit- als einen Stadtraum
wahr.
Der transparente Kristall im "vorderen" Bereich entwickelt
durchaus, besonderes nachts, eine eigene Magie. Tagsüber tummeln
sich lediglich ein paar verstreute Skater auf dem Vorplatz, ohne
dass der öffentliche Raum eine tatsächlich einladende
Ausstrahlung entwickelt. Der angestrebte urbane Eventcharakter wird
nur schwer angenommen, was allerdings auch an der unfrequentierten Rückseite des Apartmenthauses, der menschenleeren Verkehrskreuzung "Georgplatz"
und dem Weg ins Nichts zum geplanten Ferdinandplatz liegt. Die Stadt
bleibt hier ein schmerzendes, zerrissenes Provisorium.
Antibürgerliche
Attitüde
Aus der Nähe betrachtet sind die rohen Aluminium- gitterbleche
als vor den nackten Beton gehängte "Fassade" und diese
ruppige Ästhetik von Schroffheit und Härte für die
alte Residenzstadt Dresden allerdings auch ziemlich starker Tobak.
Auch in der postsozialistischen Landeshauptstadt lebt im 21. Jahrhundert
eine bürgerliche Kultur mit einer gewissen Etikette fort.
Dennoch muss man dieses außergewöhnliche "unbürgerliche"
Haus in seiner ganzen Komplexität betrachten: als eine aufs Spektakuläre
zielende, Aufsehen erregende Skulptur, als ein dekonstruktivistisches
Unikat mit archaischer Wucht. Träume der Teenager als Hauptzielgruppe
der Blockbusterindustrie bekommen hier ein Gehäuse voller Abenteuer
und Wildheit / allerdings mehr aus der Perspektive von Erwachsenen
gedacht.
Im Inneren offenbart das hohe Glasfoyer seine ganz eigene Faszination
von Raumeindrücken. Dies zirkulierende System von Treppen und
Brücken ist eine der spannendsten Raumkompositionen der zeitgenössischen
Gegenwarts- architektur Dresdens. Für die sich nach neuer Ordnung
sehnenden Kids scheint die chaotisch anmutende Architektur jedoch
zuweilen auch eine Überforderung.
Das Gebäude wirkt städtebauchlich erst durch die Folie des
langen Appartmenthauses, dessen erwogener Abriss, der das Kristallkino
plötzlich nackt, ohne "Hinterland" dastehen würde,
zum Glück abgewehrt werden konnte. 2007 wurde es saniert.
In einem Interview der DNN vom 31.Juli 04 äußerte Prof.
Wolf D. Prix, federführender Architekt beim Kristallpalast, daß
nicht alle Ideen, die ursprünglich für die Nutzung des Kinos als öffentlicher
Raum vorgesehen waren, umgesetzt werden konnten. Der Betreiber hätte
die Chancen, die in diesem Gebäude steckten, nicht wahrnehmen können. Zum Beispiel waren die Blechgitter zur Petersburger Straße eigentlich als Medienfassade gedacht, an denen die Betreiber viel stärker und optisch eindrucksvoller Filmwerbung anbringen hätten können.
Das
Kinosterben ist (vorerst) abgewendet.
Das Multiplex- Kristallkino mit Platz für 2600 Personen in 8
Kinosälen befand sich im Insolvenzverfahren. Das alte Rundkino,
dessen Keller ebenfalls für sechs zusätzliche Säle
umgebaut worden war, ist bereits nach der Flut 2002 von der UFA aufgegeben
und stand lange (mit Ausnahme des Puppentheaters) leer. Nun ist darinnen
ein anspruchsvolles 3D-Kino untergebracht.
Das Prix'sche Kritstallkino ist natürlich ein aufregender, interessanter
Bau, ein herausragendes Beispiel des westeuropäischen Dekonstruktivismus
der 90er. Trotzdem: es war ein stadtplanerischer Fehler, einer solchen
konzentrierten Massierung von mehr als 4300 Kinoplätzen an einem
Ort zuzustimmen. Auch in der höchsten Wachstumseuphorie Anfang
der 90er Jahre hätte man ein Scheitern dieser Funktionsballung
einkalkulieren müssen.
Menschen im Zentrum
Das neoexpressionistische Kristallkino ist zur Zeit das einzige Kino
der Dresdner Innenstadt vom Albertplatz bis zur TU im Süden. Nur zum
Vergleich: in der überschaubaren Altstadt vor 1945 gab es ca. ein
Dutzend Kinos, darunter die großen Lichtspieltheater UFA-Palast,
Zentrum Lichtspiele Seestraße von 1927-28, UFA Postplatz und die Scala. Drei separate Kinos
existierten allein in der ehem. Prager Straße: das Capitol,
das Universum und das Prinzeß. Im neuen 21. Jahrhundert, welches
das Massenmedium Film (durch TV, Video, Streaming, Handy und Internet) immer
mehr vom kollektiven Sehen in die Privatsphäre
abdrängt, scheint jedoch eine Umkehr dieses Trends kaum noch
möglich zu sein.
Volker Schlöndorff schlug Ende 2007 vor: die Kommunen sollten
sich an Überlegungen zur kreativen Raumgestaltung neuer Kinos beteiligen,
denn mit den neuen Medienzentren könnte das „Aussterben der Innenstädte“
verhindert werden. Als mögliche Lösung nannte er ein offenes Raumkonzept
mit Interneträumen, Geschäften und Restaurants. In Kalifornien gebe
es bereits solche Projekte.
Ufa-Palast bleibt Kino
Neuer Betreiber übernimmt die Geschäfte
Die Düsseldorfer FSF GmbH (geleitet von der Familie Riech) übernimmt
nach den Ufa-Filmpalästen in Stuttgart, Berlin und Osnabrück nun auch
das Filmtheater Kristallpalast in Dresden. Eigentümer und Vermieter
ist der Medicofonds.
„Die langwierigen Verhandlungen mit dem Vermieter führten endlich
zur Einigung – eine grundlegende Voraussetzung, um das Haus wirtschaftlich
betreiben zu können“, sagt Dikomey. „Ab 1. Oktober 2004 ist die FSF
dann offiziell neuer Betreiber.“
Homepage des Architekturbüros: www.coophimmelblau.at
Schönheitskur für Kristallpalast vorgesehen
Der Kristallpalast war 1997/1998 nach Entwürfen des Wiener Architektenbüros
Coop Himmelb(l)au (Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky) für umgerechnet
rund 25 Millionen Euro unter Ufa-Regie gebaut worden. Die letztlich
realisierte Architektur sei eher eine Spar-Variante gegenüber den
ursprünglichen Entwürfen gewesen, erläuterte Objektleiterin Silke
Dikomey. Eigentlich sei geplant gewesen, in einen dreieckigen kristallinen
Baukörper zwei Quader als Kinosäle zu hängen, die über eine langgewundene
Spiraltreppe zugänglich gewesen wären. Auch seien beleuchtete Fußböden
vorgesehen gewesen. Diese Ideen seien aber zu teuer und zu unpraktisch
gewesen. mehr: DNN vom 12.01.05
Mängel verbessern
Vielleicht kann bei dieser Gelegenheit die etwas verwirrende Ordnung
durch klarere Markierung der einzelnen Säle + Etagen und somit
eine benutzerfreundlichere Orientierung erreicht werden. Zudem täte
eine zusätzliche Schallisolierung an den Wänden zwischen
den einzelnen Sälen gut, da störende Nebengeräusche
vom Nachbarkino den Hörgenuß stark reduzieren.
---------------------------------------------------------------------------------------
Baubeschreibung
von www.baunetz.de (Jan. 07):
Das Kino in der Prager Straße in Dresden ist eines der ersten größeren
realisierten Bauten des Büros Coop Himmelb(l)au der Wiener Architekten
Helmut Swiczinsky und Wolf D. Prix dar. Deren konzeptionelle und provokante
Architekturvorstellungen wurden Ende der neunziger Jahre erstmals
mit hohem digitalem und bautechnischem Aufwand realisiert.
Das Kino wurde in Form eines verzogenen, spitzwinkligen, zerfließenden
Glaskristalls errichtet. Als Standort wählte der Bauherr eine Baulücke
zwischen der Verkehrsschneise der St. Petersburger Straße und der
Prager Straße in Dresdens Altstadt. Der neue Ufa-Palast liegt in unmittelbarer
Nähe zum bestehenden, denkmalgeschützten „Rundkino“ (1970-72 erbaut
vom Architektenkollektiv Gerhard Landgraf, Waltraud Heischkel), das
mit seiner außergewöhnlichen Rotunde das bekannteste Kino Dresdens
war.
Zur St. Petersburger Straße hin zeigt sich die rohe Betonstruktur
des Neubaus mit einem Gitterrost verkleidet. Eingangsbereich und die
gefaltete Glasfront sind zur Prager Straße hin orientiert. Im durch
Sichtbeton und Stahl geprägten Innenraum herrscht überwiegend dekonstruierte
Ruppigkeit; eine „Skybar“ schwebt als Attraktion unter dem Glashimmel.
Beton
Das Raumerlebnis lebt gleichermaßen von den ungewohnten Geometrien
und der unorthodoxen Verwendung und Fügung der Materialen Stahl, Glas
und Beton. Besonders eindrucksvoll sind dabei die haushohen Betonwände
im Foyer. Der hellgraue Beton weist eine sehr glatte Oberfläche auf.
Konstruktiv lässt sich das Kino in zwei unterschiedliche Bereiche
aufteilen: den Saalkomplex und das Foyer. Der Saalkomplex ist als
monolithisches Bauwerk mit großen Raumhöhen, Deckensprüngen und teilweise
geneigten Wänden konstruiert. Das Foyer wird von einer Glas-Stahl-Konstruktion
abgeschlossen und beinhaltet eine raumbildende Kaskade stählerner
Treppenläufe sowie zwei eigenwillig geknickte Türme für die Aufzüge.
Das Fugenbild der Betonoberflächen wurde von den Architekten vorgegeben.
----------------------------------------------------
Zerrspiegel
der Geschichte
Das waghalsige Wiener Architektenteam Coop Himmelb(l)au hat in einer
Dresdner Betonwüste das eigenwilligste Kino Deutschlands gebaut. Von
Susanne Beyer
DER
SPIEGEL 12/1998

Kristallkino vom Dach des gegenüber liegenden Studentenwohnheims aus gesehen, Foto: Juli 2013 TK
Webtipps:
https://kino.isgv.de
(Dresdner Kinokultur mit interaktiver Karte zur Geschichte des Kinos
in Dresden zwischen 1896 und 1949- leider nicht darüber hinaus)
|
|
                   
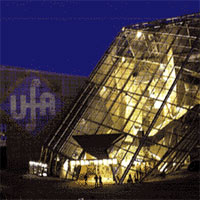 
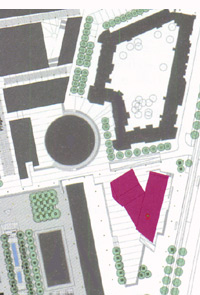 Grundriss
des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan
des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003 Grundriss
des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan
des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003

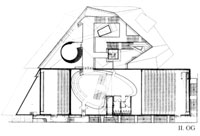
Grundriss Kristall-Kino, Vergrößerung

 Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung




Modell Kristallkino - gezeigt in der Ausstellung COOP HIMMELB(L)AU: 7+
(Aedes Galerie Berlin) , Fotos: TK 2013 |










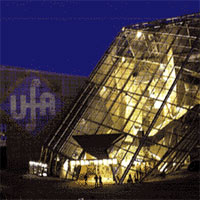
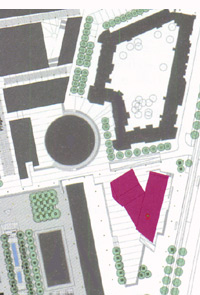 Grundriss
des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan
des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003
Grundriss
des Kristallkinos zwischen Prager und Petersburger Straße, Plan
des Stadtplanungsamtes Dresden, Oktober 2003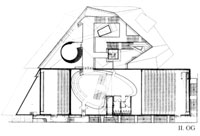
 Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung
Eingang Kino (Dez. 2011) mit sanierter Wohnzeile, Fotos: TK, Vergrößerung

