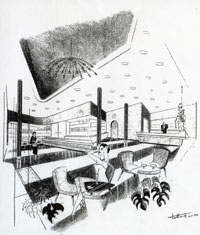|
| Städtebau: |
|
Herbert
Schneider und Kollektiv |
| Architekten: |
|
Wolfgang
Hänsch + Mitarbeiter, u.a. Gerhard Hölzel, Gerd Dettmar |
| Bauzeit: |
|
1957-
58 (1955 Beginn Planung) |
| Adresse:._ |
|
Borsbergstraße
/ Tittmannstrraße |
"Bei der Bebauung des zentralen Abschnitts der Borsbergstraße
wurde erstmals in Dresden eine Großblockbauweise unter Verwendung
von Ziegelschutt mit typisierten Elementen angewandt. Lange fünfstöckige
Wohnzeilen (Typen G5, O 2a und b) mit Satteldächern sind jeweils
unterbrochen mit Durchgängen. Am südöstlichen Ende
wurde durch ein akzentuiertes achtgeschossiges Apartmenthaus (G4)
ein Abschluß geschaffen. Dieser Hochhaus-Typ mit auskragendem
Flachdach und dreieckig herausragenden Loggien fand noch mehrfach
Verwendung als Dominante bei anderen Siedlungen. Die gegenüber
den Wohngeschossen vorgesetzten Läden in den EG bilden ein belebendes
Element. Die Putzflächen der Wohngeschosse wurden mit einem geometrischen
Muster (farblich abgesetzt) überzogen. Obwohl es bereits damals
Bedenken wegen der zu erwartenden Uniformität bei unbegrenzter
Wiederholung von Typenelementen gab, konnte hier durch relativ abwechslungsreiche
Gestaltung dieser Gefahr entgangen werden." (Architekturführer
Dresden 1997)
Wolfgang
Hänsch 2008:
"In Striesen
haben wir 1957 erstmals den Schritt von der Großblock- zur Tafelbauweise
gewagt, die raumhohe Plattenbauweise getestet, wenn Sie so wollen.
Mit dieser gestalterischen und konstruktiven Novität begann das eigentliche
industrielle Bauen in Dresden. Leider sind durch die Sanierung wesentliche
bauplastische Elemente heute überdeckt."
Das Ensemble der Borsbergstraße steht als Kulturdenkmal des Freistaates Sachsen unter Denkmalschutz.
Revolutionäre
Technologie: industriell hergestellte Fertigteil-Platten
Die große Wohnungsnot in den zerstörten Großstädten
erforderte ein schnelleres Bauen als der traditionelle gemauerte Bau.
1955 entschloss sich die DDR-Regierung, das Bauwesen zu industrialisieren.
Die Voraussetzung dafür war eine Typisierung und damit standardisierte
Vorfertigung von Gebäudeteilen. Die Typisierung war in der Sowjetunion
von Nikolai Chruschtschow im Dezember 1954 in Moskau auf einer Unions-Baukonferenz
als große Wende in Baupolitik postuliert worden.
Ab 1955 konzentrierte man sich auf die Herstellung von industriell
hergestellten Platten. In Dresden realisierte man hier in Striesen
dazu den ersten experimentellen Baukomplex. Für diese industrielle
Technologie, die an Fließbandproduktion erinnert, wurden aus
Tausenden von Trümmern Ziegel zu Splitt zermahlen, den man mit
Zuschlagstoffen vermengte und anschließend zu Blocksteinen und Platten
presste. Diese revolutionär neue Recycel-Technologie behielt
man noch einige Jahre bei, bis man dann ganz zu Zementplatten überging.
Ein nah gelegenes Betonwerk zwischen Müller Berset- und Berthold Brecht
Straße produzierte diese neue Platten.
Die rationell vorgefertigte Plattenproduktion hatte in den Westzonen
Deutschlands - u.a. mit dem Berliner Hansaviertel - einige Jahre vorher
eingesetzt. Aber auch in Ostberlin wurde schon Anfang der 1950er Jahre
mit typisierten Elemente experimentiert, so entstand z.B. 1953 ein
erster Versuchsbau auf der Stalinallee (Block C-Nord) als Stahlbetonskelettbau
in Montagebauweise.
http://de.wikipedia.org/wiki/Plattenbau
Differenzierte Bauten fürs Volk - mit urbanem Flair
Die
allgegenwärtigen uniformen 5-stöckigen Wohnzeilen mit traditionellem
Satteldach wurden hier, ungewöhnlich für den eher antiurbanen
Charakter des DDR-Nachkriegsaufbaus nach klassischen Prinzipien des
europäischen Städtebaus mit abwechslungsreichen Einzelhandelsgeschäften
versehen.
Zusätzlich lockern kleine freie Plätze das Ensemble auf.
Breite Bürgersteige verschaffen einen großzügigen
Stadt- und Lebensraum für Fußgänger, Passanten und
Stadtbürger. Aufgrund des 1957 noch geringen Autoindividualverkehr
wurden Parkmöglichkeiten außer acht gelassen. Geplant waren
allerdings Garagen für die Anwohner im südlichen Teil des
Ensembles.
Das achtgeschossige Apartmenthaus G 4 von W. Hänsch und G. Dettmar,
dessen Typus in Dresden später noch mehrmalig wiederholt wurde,
beinhaltete neben den 37 Zweiraum- und 40 Einraumwohnungen im Erdgeschoss
Läden für den täglichen Bedarf. Das letzte Obergeschoss
erhielt an seiner Ostseite fünf Atelierräume sowie fünf
dazugehörige Wohnungen für Dresdner Künstler. In der
Bauzeitschrift "Deutsche Architektur" hieß es zu diesem
Projekt: "Als Konstruktion wurde Querwandbauweise in Ziegelkonstruktion
gewählt, die auf Grund der gleichmäßigen Aufreihung
der Apartmentachsen die wirtschaftlichste Lösung brachte. Lediglich
das EG wurde in Stahlbeton-Skelettbauweise ausgeführt, um freie
Verkaufsräume zu schaffen. (...)
In jedem Geschoss befinden sich drei Gemeinschaftsbäder
für jeweils zwölf Wohnungen."
Die städtische Atmosphäre einer funktionierenden, normalen
Einkaufsstraße ist durch den guten Maßstab zwischen Gebäudehöhe
und Straßenbreite, durch Durchquerungs-möglichkeiten und
Platzfolgen stimmig.
Die
neue Borsbergstraße fällt soziologisch auf: als eine interessante
Schnittstelle zwischen der bourgeois geprägten Villenbebaung
um den Fetscherplatz und dem sozialistischen Charakter der einheitlichen,
volkstümlichen Hausblöcke.
Schöne Farben
"Besondere Beachtung wurde der farbigen Gestaltung der Häuser
gewidmet. Farbiger Edelputz und Latexanstrich geben dem Wohngebiet
eine eigene, heitere Note, die besonders im Straßenzug der Magistrale
durch die reliefartige Wirkung der Paneelkonstruktion und einer vorherrschenden
Farbgebung in Gelb und Blau gesteigert wird." (Zitat:
"Deutsche Architektur")
Aufgelockerte
grüne Stadt
Das
nebenstehende Planungsbild zeigt die angestrebte parkartige Durchgrünung
des neuen Wohngebietes.
Angedacht war ein geplanter Grüngürtel Richtung Müller-
Berset-Straße, der allerdings nicht zur Ausführung kam.
(Vergrößerung)
Lageplan:
1 - Achtgeschossiges Apartmenthaus G 4
2 - Wohnhaus G 5
3 - Wohnhaus H 3
4 - Wohnhaus H 4
5 - Wohnhaus O 1
6 - Wohnhaus O 2a
7 - Wohnhaus O 2b
8 - Wohnhaus G 3
9 - Café
10 - Kino (wurde nicht gebaut)
11 - Stationäres Kesselhaus
12 - Geplante Garagen

Hochhaus 2006 nach
der Sanierung (Foto: TK)
Architekt: Wolfgang Hänsch
(1929 - 2013)
Wolfgang Hänsch war der große Architekt des Nachkriegs-Dresden. Er hat an einer Vielzahl von Bauwerken entweder mitgearbeitet oder war planender und ausführender Leiter eines Projektes. Während die Borsbergstraße in großen Teilen in den Nachwendejahren vorbildlich saniert wurde, sind andere Gebäude von ihm entweder komplett abgerissen oder werden gerade so stark überformt, dass die ursprünglichen ästhetischen und funktionalen Qualitäten nicht mehr nachvollziehbar sind (Kulturpalast). Hänsch gilt als der "Architekt der Dresdner Moderne" und hat darüber hinaus auch als Chefarchitekt den Wiederaufbau der Semperoper geleitet, sich intensiv mit historischer Bauweise beschäftigt. Seine Verdienste für Dresden und auch Sachsen allgemein wurden mit mehreren Preisen und Ausstellungen gewürdigt. Er steht in einer Reihe mit Hans Erlwein und Paul Wolf als große prägende Architekten des 20. Jahrhunderts in Dresden.
Literatur:
Scheffler Tanja: Charme und Esprit statt Monotonie. Wolfgang Hänsch
und der Beginn des industriellen Wohnungsbaus in Dresden. In: Wolfgang
Kil (Hrsg.): Wolfgang Hänsch - Architekt der Dresdner Moderne, Berlin
2009. S. 40-59.
Lüsch, Beate: Wohnkomplex Borsbergstraße. In: LAUDEL, Heidrun
u. FRANKE, Ronald (Hrsg.) Bauen in Dresden im 19. und 20. Jahrhundert.
Dresden. 1991.
DDR-Zeitschrift:
Deutsche Architektur 2/ 1956 (und 1958)
Projektierung von Wohnbauten in Großblockbauweise
Linktipps
:
Herbert Schneider
(1903-1970; Architekt, Stadtplaner) vor dem Bebauungsplan
Dresden-Striesen mit Wohnkomplexzentrum Borsbergstraße (1955-1958;
Beginn der Großblockbauweise)
Wolfgang
Hänsch (Wikipedia)
(geb. 11. Jan. 1929, gest. 16.Sept. 2013)
|
|
           

Borsbergstraße
Planung (2. Phase)

Striesener Wohnbauvorhaben (Phase 1 der Planung- 1956) - Vergrößerung
    
Dresden, Krane
und fertiggestellte Platten in einem Betonwerk, um 1955, Foto: Deutsche
Fotothek
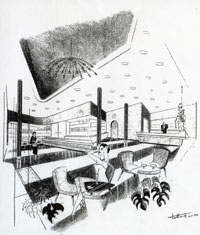
Gerd Dettmar, Wohnbebauung Borsbergstraße, Entwurfszeichnung
Appartementhochhaus C4, 1956, Innenraumperspektive Verkaufsraum. Quelle:
Sächs. Archiv für Architektur und Ingenieurbau (SAI)
|