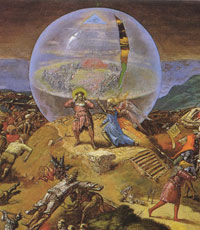|
| Architekten: |
|
Architekten
am Körnerweg -
Siegbert
L. Hatzfeldt, Dresden
www.langner-von-hatzfeldt.de
und wmb Architekten, Berlin |
| Bauzeit: |
|
2004-
05 |
| Adresse:
|
|
Wiener
Platz / Prager Straße |
| Bauherr |
|
Kurt Krieger |
Dresden
befreit sich aus dem nostalgischen Blick von außen
Architektur ist Kommunikation zwischen Sendern und Empfängern.
Das wiedervereinte Deutschland blickte anders auf Dresden, als es
die Teilhälften vor 1989 taten. Besonders Westdeutschlands ältere
Bildungsbürger reflektierten Dresden nach der "Wende",
aus ihrer eigenen Erfahrung mit der westdeutschen Nachkriegsmoderne
durch eine nostalgische, sehnsüchtige Wahrnehmung und prägten
dadurch in großen Maße das Selbstbild der Stadt, die in
den 90er Jahren zunehmend in den Strudel touristischer Vermarktung
geriet- auch aufgrund massenhaft wegbrechender Arbeitsplätze.
Mitte des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert scheint eine selbstbewusstere
Haltung eines im Heute wurzelnden Dresdens zu wachsen. Die Stadt schaut
neben der legitimen und wichtigen Denkmalpflege nach ihrem eigenen
Zukunftspotential für die Bürger der Stadt. Das Ende Mai
05 eröffnete Glaskugelhaus am Wiener Platz baut nun eine Brücke
zwischen touristischem Signal und praktischen Bedürfnissen des
Dresdner Alltags.
Kugelmythos
Der Entwurf für dieses Gebäude - nicht zu verwechseln mit
der von einem Verein angestrebten Rekonstruktion des Kugelhauses aus
dem Jahr 1928 am Großen Garten - stammt von dem aus Westdeutschland
nach Dresden gewechselten Architekturbüro Siegbert Langner Hatzfeldt
Der 15 Millionen Euro teure Neubau bemüht sich um einen Blickfang
am Wiener Platz gegenüber dem Hauptbahnhof.
Ein viergeschossiger Gebäudequader klammert das sechs Stockwerke
hohe kugelförmige Volumen ein. Die Form könnte an einen
Trackball einer Computermaus oder an die Zerbrechlichkeit unseres
Kugelplaneten erinnern. Ursprünglich
sollte das Gebäude ein Wissenschaftszentrum beherbergen, doch
konnten dafür nicht genügend Interessenten akquiriert werden.
Man plante auf eine kommerzielle Nutzung um (Boutiquen, Friseur, Fleischerei,
Tattoo- und Piercing-Studio, Apotheke). Finanziert wurde das Kugelhaus
vom Elbepark-Manager und Möbel-Höffner- Eigentümer
Kurt Krieger, nach Ikea größte Anbieter bundesweit.
Urban Renaissance in Deutschland
Das ambitionierte Haus in der sächsischen Kulturmetropole steht
stellvertretend für eine neue Urban Renaissance in Deutschland.
Cityzentren werden durch Revitalisierung und Stadtumbau mit viel Aufwand
attraktiver gemacht. Allein das Treppenhaus als Herzstück des
neuen Dresdner Kugel-hauses kostete 2,5 Millionen Euro.
Die Glaskugel dient in erster Linie der Gebäudeerschließung.
Als Treppenhaus ermöglicht es durch Rolltreppen im Zentrum der
kreisförmigen Etagen ein rasches Erreichen der Verkaufsflächen.
Im oberen Teil der Kugel befindet sich ein Restaurant mit Panoramablick.
Der Architekt Hatzfeldt greift bei seinen Entwürfen für
das exponierte Shoppinggebäude auf die Kugelhaus-Idee
von 1929 zurück. "Ich würde mich freuen, wenn es uns
gelingt, in Dresden so etwas Besonderes für Sachsen zu schaffen",
sagt Hatzfeldt. Die Idee für das Kugelhaus habe Reinhard Martin,
Chef der Aufbaugesellschaft Prager Straße, gemeinsam mit dem
Architekten Hatzfeldt und Manfred Stamm entwickelt.
Komplett kugelförmig ist die Geometrie des großen Glasballs
allerdings nicht: den unteren Teil ließ man aus statischen Gründen
weg. Eigentlich sind es nicht einmal zwei Kugelhälften, denn
am westlichen und östlichen Ende der Kugel geht der Kugelraum
ohne jede Zwischenwand direkt in die Verkaufsräume der Quaderhäuser
über.
Ingenieurtechnische Herausforderung
DNN vom 26.01.05: "Allerdings birgt die extravagante Architektur
auch Tücken: Damit das Kugelhaus nicht zum Ei wird, musste eine
sorgfältige Konstruktion her, für die eine Zwickauer Firma
zweifach gebogene Spezialrohre lieferte. Die Verglasung daran wird
mit Kugellagerschrauben befestigt, die dafür sorgen, dass sich
die Kugel bei Temperaturschwank-ungen gleichmäßig dehnt
und schrumpft. Und auch die angestrebte Transparenz birgt Probleme:
Damit im Sommer aus dem Glas kein unerträglich heißes Gewächshaus
wird, verwendet der Bauherr wärmefilterndes Glas mit einer kaum
sichtbaren Spezialbedruckung. Unter der Kugel setzt die Drewag eine
zentrale Kältemaschine ein, welche die Kugel im Sommer auf angenehme
Temperaturen bringen soll."
Erst seit wenigen Jahren ist eine schier grenzenlose Bearbeitung des
Materials Glas ingenieurtechnisch möglich geworden. Durch unterschiedlichste
Biegungen kann nahezu jede denkbare Form in Glas gegossen werden (siehe
z.B. das im Dezember 04 eröffnete Medienzentrum
Cottbus von Herzog & de Meuron, Basel). Allerdings ist die Festigkeit
der einzelnen Glasteile in der Vergangenheit auch durch beste Computertechnologie
nicht immer gewährleistet worden. Schlagzeilen machte u.a. das
Modekaufhaus Lafayette in Berlin, bei dem immer wieder einzelne Glasscheiben
zu Boden stürzten. Das Dresdner Glaskugelhaus erhielt enttäuschenderweise
jedoch keine gebogenen Scheiben, sondern platte Glasflächen.
Schade!
Für die Tragwerksplanung des Stahlbaus der Kugel verantwortlich
zeichnet Erfurth + Partner (E+P). Die Stahl- und Glaskuppel wird zusammengeschraubt,
anstatt - wie ursprünglich geplant - verschweißt.
Ende des Funktionalismus ?
Interessant ist, dass die Architektur erfunden wurde, bevor die
Nutzung feststand. Egal, ob nun ein Science Center, ein Einkaufskomplex
oder Büros entstehen, die Prinzipien des Funktionalismus, bei
der die äußere Form (und innere Grundriss-Logik) der Funktion folgen
sollen, sind bei diesem Gebäude eindrucksvoll außer Kraft
gesetzt.
Auf was verweist nun die Architektursprache des Gebäudes? Mehr
als nur Shoppingfreuden wird dieses innovative Gebäude wohl in
erster Linie Offenheit in die Zukunft signalisieren - eine gute Botschaft
neben dem Selbstbewusstsein um die glanzvolle Vergangenheit der
Dresdner Residenzstadt.
Aber vielleicht ist es in Zeiten von Flexibilität und variablen
(Um-) Nutzungen gar nicht so schlecht, etwas Theorieballast für
mehr Wachstum über Bord zu werfen.
|
|

Foto: 2005 TK

Wiener Platz, Foto: 2005 TK 
Spiegelungen, Foto: 2005 TK 
Foto: 2005 TK 


Die Visualisierung
gaukelt einen Idealzustand von Durchsichtigkeit vor, den es in der
Realität bei Tageslicht nicht gibt. 
 
Glaskugelhaus im
Rohbau - Februar 05

Rundes Treppenhaus, Aufnahme: Juli 2005

Gläserner
Aufzug im Kugeltreppenhaus in Anlehnung an den Aufzug des Kugelhauses
von 1929 (Aufnahme: Juli 05)
|
|
Städtebaulicher
Entwurf
In Anlehnung an die Vorkriegsbebauung freistehender Stadtvillen hatte
1993 das Kölner Architekturbüro Mronz & Kottmaier, kubische
Würfelhäuser als Schaufront gegenüber dem Dresdner
Hauptbahnhof entworfen. Das Büro ging damals beim Wettbewerb
zum Wiener Platz als Sieger hervor.
Mit diesem Entwurf gewinnt der Wiener Platz seine Qualität als
Stadteingang zurück, wird als Platz überhaupt erst wieder
erlebbar.
Zwei dieser Würfelhäuser wurden nun durch den Entwurf von
Hatzfeldt zu einem Quader zusammengefasst und durch das Scharnier
des gläsern-runden Treppenhauses verbunden. Damit ist die ursprüngliche
städtebauliche Idee der Reihung von sechs freistehenden Würfelhäusern
verwischt. Den Eindruck, die ursprüngliche städtebauliche
Idee abzuschwächen, unterstützt optisch noch die funktionslose
durchgehende Betonkante in Traufhöhe, die in der Innenseite die
runde Kurve spiegelt. Der eigentliche Blickfang auf die Kugel wird
dadurch jedoch leider empfindlich beeinträchtigt.
Die drei anderen Würfelhäuser wurden 2008 mit einem Bürohaus und einen InterCity Hotel bebaut.

zum Vergleich: Vorkriegsbebauung: Central Hotel am
Wiener Platz
Dresden als Großstadt in Szene setzen
Die Vorkriegssituation des Wiener Platzes war allerdings im Hinblick auf die großstädtisch hochfliegenden Träume des Dresdner Stadtplanungsamt unter Poelzig und Paul Wolf unbefriedigend. Gerade die Einmündung vom Wiener Platz zur Prager Straße zeigte eine harte Brandwand mit anschließender biedermeierlicher Villenbebauung.
(Die Gründerzeit hatte es versäumt, an dieser Ecke ein räumliches
Volumen auszuprägern. Die städtebaulich-urbane Situation blieb
ungeklärt. Hier der Zustand des Wiener Platzes von 1930: Postkarte.)
Alle diese Villen sollten schon in den 1920er und später auch in den 1930er Jahre abgerissen werden. Stattdessen sollte eine opulente Großstadtbebauung entstehen.
Während der NS-Zeit war hier am Beginn der Prager Straße ein
Großstadt-Hochhaus geplant. Keiner dieser Pläne wurde jedoch vor
1945 realisiert.
Der Preis
Die Investition des Glaskugelhaus durch den Möbelhändler
Kurt Krieger wurde durch eine umstrittene Erweiterung des großen
Möbelkaufhauses Höffner im Dresdner Elbepark "erkauft".
Kurt Krieger, der auch Möbel-Höffner-Eigentümer ist,
erbat sich von der Dresdner Bauverwaltung grünes Licht für
die Erweiterung seiner Einkaufsflächen auf
den grünen Wiesen von Kaditz/ Mickten. Die Stärkung des
Stadt-zentrums hat eben ihren Preis.
|
|

Städtebaulicher
Entwurf von Mronz & Kottmaier (1993): sechs aneinander gereihte
Würfelhäuser als Gegenüber vom Hauptbahnhof. (Bildausschnitt)

Modell Wiener Platz - Städtebaulicher Ideenwettbewerb: 1. Platz Mronz & Kottmaier, Vergrößerung, mehr Infos auf: www.dresden.de
 Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt
Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung
zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als
auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in
die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.
Ansicht,
Grundriss
Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt
Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung
zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als
auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in
die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.
Ansicht,
Grundriss
Das Projekt wurde nicht ausgeführt.
(Fotos: TK, Originale: Stadtplanungsamt
Bildstelle, Stadtarchiv)
|
|
Das Gläserne
Dresden
Bereits der Hauptbahnhof, 1892 begonnen, zeichnet sich an den Seitenfenstern
durch großzügige Glasflächen aus, die den Blick auf
den Wiener- und ehem. Bismark Platz öffnen. Das so unwiderstehliche
Baumaterial der Moderne - Glas
scheint jedoch ein Jahrhundert später, an der Schwelle des 21.
Jahrhunderts, eine absolute Dominanz zu entwickeln:
Gegenüber dem Glaskugelhaus entstand 2006 ein weiteres Glashaus
vom Investor OELSCHLÄGER Wiener Platz Dresden GmbH, als 130 Meter
langes "Tortenstück" genanntes Geschäftshaus (Homepage:
www.glashaus.tv
), welches stilistisch u.a. an das Urbis Center in Manchester von
2002 anknüpft (www.urbis.org.uk).
Desgleichen das Eingangshäuschen zum unterirdischen Parkhaus,
ebenfalls von Hatzfeld entworfen, besteht z.T. aus dem transparenten
Material Glas, wie auch das Modekaufhaus Breuninger auf der Prager
Straße. Bei so viel Durchsichtigkeit wird der Wiener Platz am
Ende wohl gar nicht mehr erkennbar sein, könnte man süffisant
fragen.
Doch tatsächlich: Innen- wie Außenräume werden bei
dem alleinigen Einsatz von Glas praktisch aufgelöst. Menschen
finden sich dann nicht mehr in haltgebenden Räumen wieder, sondern
die Raumgrenzen werden fließend und unverbindlich. Die Konzentration
des Innenbetrachters richtet sich dann nicht mehr auf die Raumwände,
sondern auf die Dinge, die hinter der Raumgrenze liegen, z.B. das
quirlende Leben auf dem Wiener Platz. Vielleicht ist solch eine interaktive
Betrachtungsweise symptomatisch für die Welt der Moderne. Nicht
die statischen, zur Schau gestellten Wände künden von den
Ideen der Gegenwart, sondern die reale Bewegung der freien-selbstdenkenden
Individuen und Gruppen. Doch ein Bekenntnis zu einer gesellschaftlichen
Idee (etwa von vorgetäuschter Transparenz) sind die inflationär
angewandten Glaswände nicht.
|
|
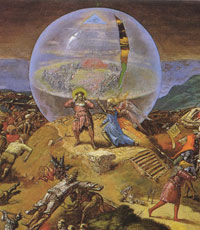
Werner Tübke:
Ausschnitt aus dem Monumentalpanorama in Bad Frankenhausen; vollendet
1989. (Eine aufbrechende Glaskugel als Zukunftsorakel und Erdball
bzw. -scheibe)
|
 Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt
Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung
zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als
auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in
die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.
Ansicht,
Grundriss
Z.B. wurde 1921 vom Hochbauamt
Dresden (Carl Hirschmann) gegenüber vom Hauptbahnhof an der Einmündung
zur Reitbahnstraße eine sehr große Baumasse, sowohl in der Breite, als
auch in der Tiefe des Grundstückes und mit 18 Stockwerken kraftvoll in
die Höhe aufragendes Bürohochhaus mit Hotel geplant.
Ansicht,
Grundriss